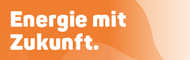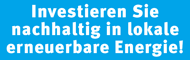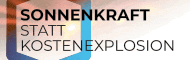Werbung

Gast-Kommentare
 Die Energiewende wird sich rentierenVon AENEAS WANNER
"Die Energiewende kostet
In Grossbritannien gibt es Gruppierungen, die an der Kernkraft-Technologie festhalten wollen und darum für eine kostendeckende Einspeisevergütung für Kernkraftwerke lobbyieren. Damit Investoren wie beispielsweise der französische Energiekonzern EDF in diese Kraftwerke investieren, müsste die staatlich garantierte Vergütung zwischen 12 und 19 Eurocents pro Kilowattstunde Strom betragen – also rund doppelt so hoch als Windstrom. 3. Mai 2013
"Energie und Elektrizität verwechselt" Im Kommentar von Egidio Cattola wird wieder einmal der Fehler gemacht den man erschreckend oft in Presseartikeln findet: die Verwechslung von ENERGIE und ELEKTRIZITÄT. Denn tatsächlich werden zwar 40-60% der ELEKTRIZITÄT in der Schweiz durch Kernkraftwerke erzeugt, aber weil diese wiederum nur knapp weniger als 20% des ENERGIE-Verbrauchs ausmacht ist die Zahl von Herrn Wanner völlig korrekt: 50% von 20% ergibt rund 10%. Und wenn wir weitweit denken, dann ist die Zahl noch wesentlich geringer.
Wichtig ist diese Unterscheidung natürlich zunächst einmal weil sie die Fakten klarstellt. Sie ist allerdings auch wichtig, weil sie mit dem gefühlsmässigen Vorurteil aufräumt, die Kernenergie leiste einen wesentlichen Beitrag zur Energieversorgung in der Schweiz oder gar weltweit. Oder sie habe gar das Potential, in nennenswertem Masse fossile Brennstoffe zu ersetzen!
Tatsache ist dass seit der ersten Industrialisierung im 19. Jahrhundert, die vor allem auf Kohle gegründet war, im Grossen und Ganzen eigentlich nur eine einzige Verschiebung stattgefunden hat: von der Kohle zu mehr Öl und Gas; alle anderen Primärenergieträger sind diesen gegenüber bisher relativ marginal. Die drei zusammen decken in der Schweiz 80% des Energie ausmachenverbrauchs, weltweit noch deutlich mehr. Und DIES ist tatsächlich die grosse Herausforderung für jegliche "Energiewende": Die Kernenergie ist da nur ein Nebenschauplatz! Allerdings ein besonders sichtbarer, weil es um unsere "höchstwertige" Endenergie geht, die am flexibelsten einsetzbar ist: die Elektrizität.
Kurz: • Kernenergie ist eine Primärenergie, die für das was sie am Ende leistet viel zu gefährlich ist und nicht nur das: auch ökonomisch macht sie keinerlei Sinn wenn man mit realen Kosten rechnet. Und dies zeigt Herr Wanner in seinem Beitrag nochmals sehr klar und deutlich. • Die wirkliche Herausforderung für die "Energiewende" ist die Substitution von fossilen Energieträgern (Kohle, Öl, Gas), wobei es da auch einige "Low-Tech"-Methoden gibt die man einfach nur installieren muss, wie etwa heizen mit Sonnenenergie – oder das Aufhängen der Wäsche anstatt dem Tumblern usw. Cornelis Bockemühl, Basel "Ich merke von einer Halbierung nichts" Andreas Wanner schreibt in seinem Beitrag, dass sich die Grosshandelspreise für Strom halbiert hätten. Davon merke ich als Konsumentin nichts. Die Strompreise steigen und steigen und laut Angaben einer Beispielsrechnung im Internet sind von einem Rechnungsbetrag von Fr. 1125.99 Fr. 364 Stromkosten, Fr. 372 Netzkosten und Fr. 324 Abgaben für die Umwelt, die dann dafür benutzt werden um geschuldete Krankenkassenprämien zurückzuzahlten. (CO2-Abgabe) Vielleicht könnte Andreas Wanner einmal sein Mandat bei der IWB dazu nutzen, dass auch den Konsumenten/innen erklärt wird, wie sich die Gebühren zusammensetzen und in welchen Taschen sie schlussendlich verschwinden. Von der Propaganda wegen der Klimaerwärmung habe ich langsam die Nase voll. Für mich ist alles nur ein Vorwand um den Konsumenten/innen weiterhin abzuzocken. Alexandra Nogawa, Basel "Gravierende Überlegungsdefizite" Dem "energiewendefreudigen" Autor (Umweltnaturwissenschafter ETH mit MBA HSG, ist Geschäftsleiter von Energie Zukunft Schweiz, grünliberaler Basler Grossrat und Verwaltungsrat der Industriellen Werke Basel-Stadt IWB) sind einige gravierende Überlegungsdefizite unterlaufen. Der Anteil des KKW-Stroms in der Schweiz beträgt im Winter 60%, im Sommer 40% und nicht wie behauptet 10%.
Denn die rund um die Uhr laufende Kernkraftwerke erzeugen übers Jahr 85 bis 90 Prozent der in der Schweiz benötigten Strommenge. Solaranlagen aber nicht einmal 10%. Das heisst: Für die Jahresproduktion aller bisher durch die KEV geförderten Anlagen von 1350 Gigawattstunden machte die Fotovoltaik gerade mal 6 Prozent aus. Da müsste das KKW Leibstadt 47 Tage laufen. Und den Strom der zusätzlichen Solaranlagen, die der Nationalrat mit 350 Millionen fördern will, liefert es in 5 Tagen.
Die Autoren-Behauptung, dass der Umbau des Energiesystems zwischen 40 bis 100 Milliarden beträgt stehen die Berechnungen von anderen seriösen und wissenschaftlichen Studien 300 Milliarden entgegen. Frage: welcher Betrag ist es nun? Zudem stellt sich noch eine weitere Frage, was der unsinnige Kostenvergleich der Energiewende mit dem Budget der Landesverteidigung zu tun hat! Egidio Cattola, Riehen |
www.onlinereports.ch
© Das Copyright sämtlicher auf dem Portal www.onlinereports.ch enthaltenen multimedialer Inhalte (Text, Bild, Audio, Video) liegt bei der OnlineReports GmbH sowie bei den Autorinnen und Autoren. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Veröffentlichungen jeder Art nur gegen Honorar und mit schriftlichem Einverständnis der Redaktion von OnlineReports.ch.
Die Redaktion bedingt hiermit jegliche Verantwortung und Haftung für Werbe-Banner oder andere Beiträge von Dritten oder einzelnen Autoren ab, die eigenen Beiträge, wenn auch mit Zustimmung der Redaktion, auf der Plattform von OnlineReports publizieren. OnlineReports bemüht sich nach bestem Wissen und Gewissen darum, Urheber- und andere Rechte von Dritten durch ihre Publikationen nicht zu verletzen. Wer dennoch eine Verletzung derartiger Rechte auf OnlineReports feststellt, wird gebeten, die Redaktion umgehend zu informieren, damit die beanstandeten Inhalte unverzüglich entfernt werden können.