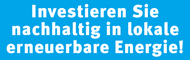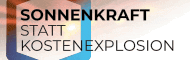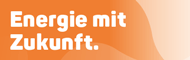Werbung

Peter Achten: "Basilea"
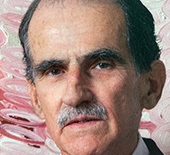 Die Geborgenheit im Basler LuftschutzkellerZu den prägenden Eindrücken meiner frühen Kindheit gehört der Luftschutzkeller im Haus an der Kandererstrasse beim Erasmusplatz. Die Luftschutzsirenen wimmerten über Klein- und Grossbasel. Meist in der Nacht. Die Erinnerungen gehen zurück auf die Jahre 1943 bis anfangs 1945. Der Keller war gut eingerichtet. Wasser zum Trinken und Kleinigkeiten zum Essen lagen bereit. Am Boden eine Matratze für mich und meine Schwester. An der Seite mit Stoff bezogene Campingstühle für Mutter, Oma und Vater. Papa war allerdings selten dabei, denn er war im Aktivdienst, meist in Rothenfluh und bei Kriegsende mit weit über tausend Diensttagen. Im Keller angekommen legten wir uns auf die herrlich weiche Matratze mit dem Kopfkissen und der warmen Decke. Dazu gab es jedes Mal einen Riegel Milchschokolade, eine Rarität mitten in der Kriegszeit mit den Lebensmittelrationen. "In Basel krachten amerikanische Bomben Natürlich hatte die Schweiz Glück. Es fielen zwar Bomben auf Zürich, Stein am Rhein oder Basel. Am schlimmsten betroffen war Schaffhausen mit mehr als fünfzig Todesopfern und Hunderten von Verletzten. In Basel krachten amerikanische Bomben auf den Güterbahnhof. Noch gut erinnere ich mit anfangs 1945 an die tiefen Bombenkrater, die ich an der Hand meines Vaters und vielen weiteren Zuschauern besichtigen konnte. Was erlitten Kinder und Erwachsene in dem von Nordkorea entfachten Koreakrieg (1950-53), was in dem von Maos Utopien verursachten grossen Hungersnot während des "Grossen Sprungs nach Vorn" (1958 bis 1961) mit je nach Schätzung 35 bis 45 Millionen Toten? Nicht weniger blutig ging es zu mit dem von der westlichen Lichtgestalt John F. Kennedy angefachten heissen Phase des amerikanischen Krieges in Vietnam und dem von seinem Nachfolger Lyndon B. Johnson und Verteidigungsminister McNamara 1965 mit einer blanken Lüge ausgeweiteten Konflikt. In den 1990er Jahren kam es in Ex-Jugoslawien, nur wenige hundert Kilometer von der Schweiz entfernt, zu wüsten Exzessen. Srebrenica oder Sarajewo mögen als Beispiele dienen. In Afrika kam es zum Völkermord der Hutus an den Tutsi mit fast einer Million Todesopfern, unterstützt von regierungsnahen Radiosendern sowie von Priestern. Die in Nordkorea vom "Geliebten Führer" Kim Jong-il mit seiner verfehlten Agrarpolitik verursachten Hunger-Katastrophe Mitte der neunziger Jahre forderte zwischen anderthalb bis zwei Millionen Todesopfer, darunter vor allem Kinder und schwache Alte. Im neuen Jahrtausend folgten Kriege im Irak, Syrien oder Libyen. Das ist eine unvollständige Aufzählung von Katastrophen, die von Menschen in den letzten siebzig Jahren verursacht worden sind. Dafür sind nicht, wie die USA als selbsternannte Vorkämpfer der Menschenrechte immer wieder behaupten, nur autokratische oder diktatorisch geführte Staaten verantwortlich. Das Gefühl der absoluten Geborgenheit im Luftschutzkeller war im Rückblick ein Schweizer Luxus. Dass viele Millionen Kinder das nie erleben durften, ist nach so vielen Jahrzehnte bedrückend. Und vielleicht Ansporn für die junge Generation. 22. Februar 2021
"Rätselhafte Beschuldigung" Mit Jahrgang 1938 war Frau Nogawa gerade mal sieben Jahre alt und kann sich besser "erinnern" als renommierte Historiker mittels Dokumenten und Gerichtsakten belegen können. Warum sie auch hier den Bundesrat posthum beschuldigt, bleibt ihr Rätsel. Fakt ist: Die Bombardierung am 4. März 1945 um 10.13 Uhr betrafen das Gundeldinger-, St. Alban- und Breitequartier und beruhen nachweislich auf einem Irrtum. Pat Schlenker hat dieses Ereignis in seinem Blog eindrücklich und spannend lesbar aufgearbeitet. Daniel Kobell-Zürrer, Basel "Nicht unbedingt ein Ruhepunkt" Der Zweite Weltkrieg war für Basel nicht unbedingt ein Ruhepunkt, obwohl man von den Medien den Eindruck gewinnt, die Schweiz hätte sich in Wohlstand gesuhlt. Man hatte Angst, dass die Deutschen angreifen würden, und meine Grossmutter ist ins Welschland geflohen, wo allerdings jenseits der Grenze bereits die Deutschen standen. Alexandra Nogawa, Basel |
www.onlinereports.ch
© Das Copyright sämtlicher auf dem Portal www.onlinereports.ch enthaltenen multimedialer Inhalte (Text, Bild, Audio, Video) liegt bei der OnlineReports GmbH sowie bei den Autorinnen und Autoren. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Veröffentlichungen jeder Art nur gegen Honorar und mit schriftlichem Einverständnis der Redaktion von OnlineReports.ch.
Die Redaktion bedingt hiermit jegliche Verantwortung und Haftung für Werbe-Banner oder andere Beiträge von Dritten oder einzelnen Autoren ab, die eigenen Beiträge, wenn auch mit Zustimmung der Redaktion, auf der Plattform von OnlineReports publizieren. OnlineReports bemüht sich nach bestem Wissen und Gewissen darum, Urheber- und andere Rechte von Dritten durch ihre Publikationen nicht zu verletzen. Wer dennoch eine Verletzung derartiger Rechte auf OnlineReports feststellt, wird gebeten, die Redaktion umgehend zu informieren, damit die beanstandeten Inhalte unverzüglich entfernt werden können.