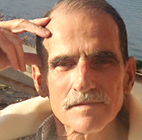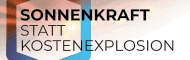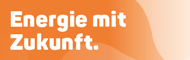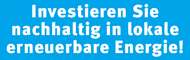Kim Jong-un: Biedermann oder Brandstifter?
Der dynastische Jung-Tyrann Kim Jong-un nahm neulich den Mund ziemlich voll. Den Erzfeind Amerika etwa drohte er von der "Landkarte auszuradieren". Ob solch frivol-apokalyptischer Sprüche gerieten westliche Medien in einen Ausnahmezustand. Die Spannungen stiegen. Experten aller Denominationen meldeten sich zu Wort und äusserten – in Teeblättern lesend – Tiefgründiges zum nach Aussen ziemlich isolierten Einsiedlerstaat Nordkorea. Die Politiker wiederum taten so, als stünde die Welt kurz vor einem thermonuklearen Krieg. Kurz, der Blick auf den real existierenden Sozialismus im Arbeiterparadies nordkoreanischer Prägung ist verlorengegangen.
Der "junge General" Kim Jong-un jedenfalls hat seinen Vater – den "geliebten Führer" – und Grossvater Kim Il-sung – den "Präsidenten in alle Ewigkeit" – in einem bereits übertroffen. Er meistert die hysterische Propaganda in Perfektion. Die Welt und vor allem der Erzfeind USA horchen auf. Das war und ist die Absicht. Atom-Drohungen als höchste Form der psychologischen Kriegsführung sozusagen.
Ausländische Touristen derweil wollen Zeichen den Wohlstandes in der Hauptstadt Pjöngjang gesehen haben. "Ganz anders", meinte ein amerikanischer Tourist, "als uns die Lage von unserer Regierung und unseren Medien geschildert wird". Sicher, Pjöngjang ist kein potemkinsches Dorf. Allerdings leben in der nordkoreanischen Hauptstadt nur jene, welchen die Führung absolut vertraut. Das ist die satt ernährte Elite aus Partei, Armee, Wissenschaft und Geheimdienst, die Kim Jung-un und die ihn umgebende Führung bei Laune halten müssen. Schliesslich geht es um den Machterhalt. Das ist die zwei bis drei Millionen Menschen umfassende "neue nordkoreanische Mittelklasse", von der einige ausländische Experten schwadronierend ökonomische Wunder erwarten.
Aber: In Nordkorea gibt es grob gesehen drei Schichten. Eine zweite Schicht setzt sich aus der grossen Mehrheit der Arbeiter, Bauern und Intellektuellen zusammen. Das Fussvolk sozusagen, dem das Regime nicht hundertprozentig über den Weg traut. Die letzte Schicht schliesslich sind die Illoyalen, Volksfeinde, Abtrünnigen, Verräter und deren Familien, denn es gilt Sippenhaft. Viele sitzen in einem übers ganze Land verzweigten Netz von Arbeits- und Konzentrationslagern. Experten schätzen den Anteil dieser Schicht auf rund ein Fünftel bis ein Viertel des 25-Millionen Volkes. Pjöngjang ist mit andern Worten die Krone des real existierenden Sozialismus mit Vorrechten, von denen das gemeine Volk in den Provinzen nur träumen kann.
Nordkorea also ist nicht Pjöngjang. Gesicherte statistische Daten sind zwar nicht erhältlich, doch aus dem, was südkoreanische Universitäten, die Asiatische Entwicklungsbank, andere Internationale Organisationen sowie Geheimdienste zusammen getragen haben, ergibt sich ein wirtschaftlich wenig erfreuliches Bild. Angefangen beim fundamentalen Bedürfnis nach Nahrung. Gewiss, Nordkorea hat wenig Anbaufläche und dazu oft Trockenheit und Überschwemmungen. Das haben jedoch auch andere Länder, ohne das Volk Hunger leiden zu lassen. Eine verfehlte, planwirtschaftlich gelenkte Landwirtschaft, zuwenig Düngemittel, veraltete Technik – dass alles trägt zur desolaten Versorgung bei. Dazu kommt ein Verteilungssystem, das im Zuge der "Militär zuerst"-Politik die Streitkräfte bevorzugt.
"Alles ist extrem korrupt. Mit Geld lässt sich
alles und jedes kaufen."
Die grosse Hungersnot in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre hat fast einer Million Menschen das Leben gekostet. Auch heute herrscht noch Lebensmittelknappheit. Nach UNO-Angaben sind ein Viertel der Bevölkerung mangel- oder unterernährt. Nordkorea hängt am Tropf internationaler Lebensmittelhilfe. Nordkoreaner sind durchschnittlich sechs Zentimeter kleiner als Südkoreaner. Die mittlere Lebenserwartung liegt mit etwas über 60 Jahren sehr tief.
Die Infrastruktur von Industrie und Transport ist in einem desolaten Zustand und veraltet. Die Energieversorgung ist prekär und die Produktivität gering. Ein Nordkoreaner produziert gemessen am Brutto-Inlandprodukt durchschnittlich zehnmal weniger als ein Südkoreaner. Dreissig bis vierzig Prozent des Staatshaushaltes wird für die 1,3-Millionen-Mann-Armee aufgewendet. Was Nordkorea am Überleben hält, ist eine Schattenwirtschaft, in der private Händler, Bauern mit kleinen Gemüsegärten, kleine und mittlere Unternehmer, Werkstattbesitzer, Restaurantbetreiber und Schmuggler aktiv sind. Das ist zwar nach Massgabe der allmächtigen Arbeiterpartei illegal und kriminell. Das ungesetzliche Treiben könnte jederzeit unterbunden werden, doch es wird zeitweise stillschweigend toleriert und hält das System am Überleben.
Oft sind die Grenzen zwischen privat und staatlich in dieser informellen Wirtschaft nur noch schwer zu ziehen. Alles ist möglich, und alles ist extrem korrupt. Mit Geld lässt sich alles und jedes kaufen. Nicht zu übersehen auch, dass das oft als "Eremiten"-Reich apostrophierte Land längst nicht mehr so hermetisch von der Aussenwelt abgeschnitten ist, wie es den Anschein macht. Die Elite verfügt zwar noch nicht über Internet und weltweit durchschaltbare Handys. Aber ein Intranet und Mobilfunknetz mit bereits einer Million Handys lassen die Informationen im Innern des Landes fliessen. Von wirtschaftlichen Reformen, wie sie viele Experten und Beobachter vom Jung-Tyrannen Kim Jong-un erwarten, ist freilich noch nichts zu sehen. In den letzten zehn Jahren gab es verschiedene Reform-Versuche in der Landwirtschaft und der Industrie, die aber alle wieder im Keim erstickt worden sind.
Nordkorea jedoch ist ein potentiell sehr reiches Land. Vor allem Bodenschätze und seltene Mineralien sind reichlich vorhanden. Dazu kommt ein Heer disziplinierter, fleissiger und gut ausgebildeter Arbeiter, Bauern und Hochschulabsolventen. Der Traum von einem Billiglohn-Land par excellence. All diese Vorteile freilich sind mit der ständigen atomaren Drohkulisse kaum in der Wirklichkeit umzusetzen. Devisen besorgt sich das Land derzeit vornehmlich mit Export von Rohstoffen nach China, Waffenhandel, den Löhnen von Wanderarbeitern, dann aber auch mit einer Reihe von illegalen Geschäften vom Drogenhandel über Falschgeld bis hin zu gefälschten Zigaretten.
China ist mit Nordkorea zwar nicht mehr derart befreundet, wie zur Zeit von Kim Il-sung, dem 1994 verstorbenen "Präsidenten in alle Ewigkeit". Wenn die Freundschaft auch nicht mehr wie einst so "eng ist wie Lippen und Zähne" ist, so spielt das Reich der Mitte wirtschaftlich noch immer die Hauptrolle, obwohl das atomare Säbelrasseln des Erb-Diktators Kim Jong-un auch in Peking extrem schlecht ankommt. China liefert rund rund fünfzig Prozent aller Lebensmittel und 90 Prozent aller Waren des täglichen Bedarfs, ist für 85 Prozent aller Erdöllieferungen, für 90 Prozent aller Auslandinvestitionen und für 50 Prozent aller Nahrungsmittelimporte sowie drei Viertel allen Handels verantwortlich.
Peking hat zwar schon Kim Il-sung, dann dessen Sohn Kim Jong-il und nun dem Enkel Kim Jong-un nahegelegt, doch nach chinesischem Vorbild zu modernisieren. Motto etwa: Marktreform und Machterhaltung. Doch Jungspund Kim und seine Umgebung wollen auf Nummer sicher gehen. Das wiederum heisst, dass sie die Partei, die Armee und den Geheimdienst von Reformen überzeugen müssen. Und überzeugen heisst vor allem, die Macht und die damit verbundenen Privilegien erhalten.
Die neue, offizielle Parteilinie heisst vorerst "Leichtindustrie und Atomwaffen". Was nicht unterschätzt werden sollte, ist die Tatsache, dass vermutlich die Mehrheit des Volkes – abgeschnitten von internationalen Informationen und abhängig von der heimischen Propaganda – sich von den USA, Südkorea und Japan tatsächlich bedroht fühlt. Der Mythos vom ausgewählten, von Feinden umgebenen reinrassigen Volk wird nicht erst von den Kommunisten gefördert. Nicht zu vergessen die Vergangenheit, wo China seit Jahrhunderten und vornehmlich Japan im 20. Jahrhundert eine unrühmliche Rolle spielten. Vor diesem Hintergrund ist die für ausländische Ohren extrem schrill formulierte nordkoreanische Propaganda zu interpretieren.
Auf Atomwaffen wird der junge Kim nie verzichten. Das ist seine Versicherung. Reformen werden erst dann kommen, wenn die Kontrolle des Volkes garantiert ist, sowie Partei, Armee und Geheimdienst überzeugt werden können, dass ein wirtschaftliches Schlaraffenland für alle nicht destabilisiert. Kim Jong-un versprach ja schon zum Neuen Jahr, 2013 werde "ein Jahr der grossen Schöpfungen und Veränderungen, die einen radikalen Umschwung bewirken" und das Land zu einem "wirtschaftlichen Riesen" machen werden. Ist Jung-Tyrann Kim Jong-un nun ein Reform-Biedermann oder ein Brandstifter? Die kommenden Monate und Jahre werden die Frage beantworten.
8. Mai 2013