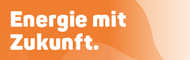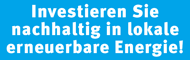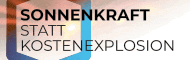Fuck, sie killen die deutshe Sprache!
Von PETER KNECHTLI
Wir Journalisten sollten uns schämen. Shame on us! Wir, die wir uns doch immer stolz als die "Vierte Gewalt im Staat" – nämlich die politische, kulturelle und gesellschaftliche Kontrollinstanz – bezeichnen, befinden uns in einem Fahrwasser, das es gerechtfertigt erscheinen lässt, uns selbst durch eine vielleicht Fünfte Gewalt auf die Tatzen hauen zu lassen.
Wir, die wir gern Andere an die Regeln des Anstands, der Fairness, des wahrhaftigen Verhaltens erinnern, betätigen uns an vorderster Front als Totengräber der deutschen Sprache.
Ich will mich gar nicht ausnehmen. Beim Redigieren meiner eigenen Texte fällt mir immer wieder auf, dass ich mit Fremdwörtern Freudentänze aufführe, mit unerklärten Fachbegriffen unverständlich bleibe oder mit Abkürzungen jongliere, die nicht Eingeweihte nicht verstehen, und dann aufhören zu lesen. Das sind Momente, in denen ich mich mitschäme – nämlich dafür, dass ich meine, es reiche aus, für eine Insider-Elite zu schreiben. Es folgt dann eine Überarbeitung der Texte, die ich danach – Ausnahmen immer noch vorbehalten – für allgemein verständlich halte.
"Wir Medienschaffenden sind
die Killing-Vorbeter der deutschen Sprache."
Wir Medienschaffenden sind mit unserem cool adaptierten Import-Vokabular die Versager und – Fuck! – die Killing-Vorbeter der deutschen Sprache. Allein in den letzten Tagen sind mir Text- und Ton-Beispiele aufgefallen, die alle Alarmglocken schrill aufläuten lassen müssten. Da verwendeten sie Begriffe wie Catcalling, von Boostern wollen wir gar nicht erst reden, das haben uns die Behörden vorgekaut – und wir recyclen sie ungefragt. Dieselbe Nachäfferei trifft auf neuvirale Begriffe wie Pooling, Depooling und boostern zu.
Wir, die ach so kritischen Viertgewaltler verwenden sie weiter, ohne unsere Gesundheitsbehörden, Virologen inbegriffen, darauf zu verpflichten, in unserer angestammten Schriftsprache zu communicate, und nicht in diesem anglizistischen Kauderwelsh. Wir fördern die Verluderung der Sprachkultur, statt sie nach Kräften zu erhalten.
Da lesen wir von designten Zeitschriften, die für die Producers eine heavy challenge gewesen seien. Wir bieten Selfis zum Streamen in den Social Media, verleihen uns den entscheidenden Boost, indem wir die low hanging fruits abgarnieren. Denn wir wollen auf track bleiben, mit dieser Pace mithalten und damit Number one bleiben, denn communication is key.
Doch Vorsicht: die Careleavers könnten uns die false balance unserer Medien unter die Nase reiben, wenn wir nicht checken, dass Change will come either way, denn die Klima-Jugend mit ihrem System Change gibt uns das Ranking vor. Wenn ein Club-Besitzer all in geht, dann lässt sich das am Deadline-Day ablesen. Die Mitglieder der IG Greenwashing sind politische Outlaws – weit entfernt davon, der Fear of missing out, der Angst, etwas zu verpassen, zu verfallen.
Wenn sich der englische Einfluss auf unsere Sprache im derzeit exzessiven Tempo weiter verbreitet, so wird "deutsch" bald "deutsh" geschrieben.
Wir meinen, mit dieser Sprachverhunzung zum Mainstream zu gehören, weil die Youngsters unsere Kunden von morgen sind. Dabei verlieren wir Elitäre gerade all jene Medienkonsumierenden, die keine Fremdsprachen sprechen, mit englischen Begriffen nie vertraut gemacht wurden und die dadurch nicht verstehen, und mit unerklärten Abkürzungen nichts anzufangen wissen.
Der Höhepunkt der neuen Unverbindlichkeit drückt sich im Gendern aus, wo jede und jeder meint seinen eigenen Weg gehen und andern vorschreiben zu müssen.
Der deutsche Star-Satiriker Dieter Nuhr hat in seinem Jahresrückblick 2021 konstatiert, dass sich in diesem Jahr das Gendern durchgesetzt habe – "gegen den Willen der Mehrheit, aber wen interessiert das!" Er meinte unter vielsagendem tosendem Applaus: "Kaum eine Sendung im Fernsehen, in der nicht durch einen Schluckauf der Sprecher ...Innen ... demonstriert würde, dass man gesinnungstechnisch auf der Seite des Fortschritts ist und nicht auf den Seiten des dummen Publikums, dem das mehrheitlich auf den Sack geht."
Wir Journalistinnen und Journalisten hätten es, mehr als jede andere Berufsgruppe, in der Hand, dem grassierenden Zerfall der deutschen Sprache durch anglizistische Unterwanderung entgegenzuwirken. Indem wir Texte schreiben, die verstanden werden und nicht nur cool wirken sollen.
Mehr über den Autor erfahren
Kommentar gefallen? Twint-Spende an Recherchierfonds:

31. Dezember 2021
"Sprachkompetenz kommt mehr und mehr abhanden"
Der Kommentar spricht mir aus dem Herzen. Oft gäbe es ja durchaus gebräuchliche deutsche Wörter für die tatsächlich verwendeten englischen, z. B. Auffrischimpfung anstatt Booster. Aber sie sind halt fast ebenso oft auch länger und schwerfälliger als die englischen Wörter.
Englische Ausdrücke können die meisten von uns als solche erkennen (auch wenn sie nicht alle auf Anhieb verstehen), und ich gehe mit Peter Knechtli einig, dass weniger Englisch den Schweizer und deutschen Medien gut anstehen würde. Gleichzeitig fürchte ich jedoch, dass ausser dem Englischen noch andere, womöglich heimtückischere "Killer" am Werk sind. In der geschriebenen Sprache scheint mir allgemein die Sprachkompetenz mehr und mehr abhanden zu kommen – von der Rechtschreibung, über den falschen Kasus (z. B. Dativ statt Genitiv, Nominativ statt Akkusativ) bis hin zur fehlerhaften Konjugation von Verben; Kommas werden, wenn überhaupt, mit dem Salzstreuer – mit einer gewissen Beliebigkeit eben – gesetzt; aber das ist das kleinste Übel. Flüchtigkeits- und Tippfehler runden das Ganze ab.
Aber was will man anderes erwarten in einer Zeit, in der es immer weniger eine Rolle spielt, wie man etwas schreibt, solange man versteht, was gemeint ist? In einer Zeit, in der Lehrer, pardon: Lehrpersonen die Aufsätze ihrer Schülerinnen und Schüler, wenn überhaupt, nur noch sehr zurückhaltend korrigieren dürfen? (Dabei fällt mir übrigens ein: Gender-Sternchen und -Doppelpunkte sind der Sprachkompetenz auch nicht eben zuträglich und erschweren vor allem die Lesbarkeit geschriebener Texte, während sich in der gesprochenen Sprache die Kunstpause vor dem weiblichen Anhängsel -innen fast wie ein Schluckauf anhört.)
Noch viel schmerzhafter ist in meinen Augen jedoch die Verarmung unserer Mundart. Ich nenne zwar auch nur noch ein dickes Buch Schungge – das Fleischerzeugnis vom Schwein ist auch in meinem Sprachgebrauch ein Schingge. Aber immer öfter höre ich Träppe anstatt Stääge, Küelschrank anstatt Yyskaschte, Krankehuus statt Spital oder Tüüte oder Sack statt Gugge und ähnliche Germanismen.
Und dann gibt es da noch die "Turigismen" und "Argovismen" – vor allem lautliche "Unreinheiten" und zurzeit leider beinahe täglich im Regionaljournal Basel zu hören, z. B. überchoo, vierzg, zwanzzweiezwanzg, chlyy, choo – die Liste lässt sich beliebig verlängern. Es sind, wohl gemerkt, nicht Sprecherinnen oder Sprecher aus dem Kanton Basel-Landschaft, sondern sie sind als Basel-Städterinnen und -Städter zu erkennen. Aber sie sprechen einen Dialekt irgendwo zwischen Züüridütsch, Baasel(bieter)dütsch, Hösch-Sprooch und Aargauer oder Solothurner Mundart. Ich befürchte, unter dem Einfluss der Standardsprache und des übermächtigen Zürcher Dialekts hat ein einigermassen gepflegtes Baaseldütsch einen immer schwereren Stand. Auch die für die Stadtbasler Mundart so charakteristische Entrundung (z. B. briele – nicht wie z. B. auf Züüridütsch brüele – für brüllen) hört man immer seltener. Es muss keineswegs Baaseldytsch sein, aber ich habe den Eindruck, den Sprechenden fehlt häufig das Bewusstsein für die unterschiedlichen Mundarten und deren Reichtum.
Gleichzeitig hege ich allerdings auch den Verdacht, dass sich ausser mir und einer Handvoll weiterer Sprachperfektionistinnen und -perfektionisten (manche mögen uns auch Puristen schimpfen) kaum jemand über die zunehmende Sprachinkompetenz sowohl bei der geschriebenen als auch bei der gesprochenen Sprache aufregt.
Gaby Burgermeister, Basel
"Einflüsse verarmen die deutsche Sprache"
Sie haben so Recht mit Ihren Anmerkungen, wie die Sprache, vor allem die deutsche Sprache von Einflüssen nicht bereichert wird, wie man das ja annehmen könnte, sondern "verarmt".
Die Fähigkeiten und Möglichkeiten sich auszudrücken, bietet unsere Sprache in hohem Masse und ebenso wie "Guetdytsch" bietet auch der Dialekt eine unerschöpfliche Palette von Möglichkeiten.
Was ist geschehen? Fehlt den Schreibenden die Musse, über den Gegenstand der Betrachtung nachzudenken, fehlt ihnen die Musse, sich dann mit Worten an das Gesehene anzunähern? Ich weiss es nicht:
Ich nehme den Anlass, Ihnen zu danken für Ihre Kommentare, die ich als journalistische, gut, ich übertreibe jetzt ein wenig, "Leckerbissen" empfinde. Möge das Neue Jahr den Medien einen Stern weisen, der sie hin führt zur "Einfalt und Grösse".
Hans Stelzer, Basel
"So 'cool'"
Diesen Artikel finde ich so "cool".
Peter Mesmer, Muttenz
"Zeitungen fliegen schnell in den Papierkorb"
Lieber Peter Knechtli, Du hast den Nagel (wieder einmal) auf den Kopf getroffen: Gratuliere! Um mich in "deutschen" Texten nicht dauernd über Anglizismen-Kauderwelsch ärgern zu müssen, habe ich mir angewöhnt, beim ersten englischen Wort abzubrechen und zum nächsten Text weiterzugehen, und zwar nach der gleichen Methode. Du kannst Dir vorstellen, wie schnell so die heutigen Zeitungen in den Papierkorb fliegen.
Übrigens: Auch ich weiss immer noch nicht, was boostern heisst, obwohl ich die dritte Impfung seit Mitte November schon habe.
Peter Amstutz, Sursee
"Kaum waren sie in der Stadt tätig ..."
Wenn Leute Fremdwörter brauchen, die mit grosser Wahrscheinlichkeit andere nicht verstehen, so hat dies damit zu tun, dass sie sich "gebildet" geben wollen, angeben wollen. Fachleute unter sich, also mit anderen Fachleuten brauchen Fachbegriffe. Das macht Sinn. Sie können sich so präzise und schnell ausdrücken. Verwenden sie jedoch diese Begriffe im Gespräch mit Leuten, die nicht in ihrem Fach beheimatet sind, so ist dies entweder arrogant oder zeugt von wenig Einfühlungsvermögen.
Ich kenne Leute, die wie ich im Baselbiet aufgewachsen sind und entsprechend redeten. Kaum waren sie jedoch in der Stadt (Basel) tätig, so sagten sie statt "mir gönge, mir wei..." "mir göhn, mir wänn…"). Damit wollten sie vermutlich sagen: So spricht man in der Stadt, das ist "gehobenere" Sprache. Oberbaselbieter, die in den Landrat gewählt werden, reden plötzlich die Sprache der Politiker, auch wenn dies lange nicht alle verstehen. Englisch ist in den letzten Jahren zur gemeinsamen Sprache vieler geworden. Es gibt Chefs grosser Schweizer Firmen, die nicht Deutsch sprechen. Die gemeinsame Sprache an vielen Instituten Schweizer Unis ist Englisch.
Eduard Strübin, ehemaliger Seklehrer und Volkskundler in Gelterkinder, sammelte damals moderne Ausdrücke Jugendlicher. Er beurteilte diese Jugendsprache nicht, er stellte einfach fest, dass Junge andere Ausdrücke verwenden, um sich von den Alten abzugrenzen. Man weiss, dass viele der heutigen Alltagsausdrücke in früheren Jugendsprachen ihren Ursprung hatten.
Zurück zu Ausdrücken, die andere nicht verstehen, zu Anglizismen und weiteren Lehnwörtern aus anderen Sprachen. (Das Wort Gallizismen gibt es tatsächlich, ich kenne es seit etwa einer Stunde.) Ich schätze es sehr, wenn Leute ihre erlernte Sprache (inklusive ihren ursprünglichen Dialekt) sprechen, ohne ach-so gescheite Ausdrücke zu verwenden. Wenn man dies üben möchte, so soll man sich doch Zeit nehmen, kleinen Kindern ihre Fragen so lange zu beantworten bis sie zufrieden sind. (Dies geht nicht mit Anglizismen und nicht mit Fremd- und Fachwörtern.)
Wer im Internet unter "Gallizismen" sucht, findet unter anderm eine lange Liste mit solchen Wörtern, die in unserer Alltagssprache als nicht mehr fremd empfunden werden.
Ueli Bieder, Gelterkinden
"Schiller wūrde sich im Grabe drehen"
Lieber Herr Knechtli, da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Grauenvoll ist auch die Sternchen-Formulierung. Vielleicht kann man doch noch zurück zu den Wurzeln? Schiller wūrde sich im Grabe umdrehen, wenn er sähe, was mit der deutschen Sprache geschieht. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins neue, hoffentlich nicht mehr so stachliche Jahr. Alles Gute und bleiben Sie weiterhin aufmerksam und kritisch, herzlichen Dank.
Esther Hug, Aesch