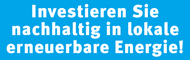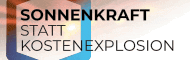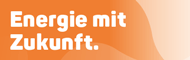Werbung

|
© Fotos bei Monika Jäggi, OnlineReports.ch
 "Wir sehen uns als Pioniere": Nahrungs-Fabrik Urban Farmer-Box
Die Stadt-Bauern kommen: Fische und Gemüse auf dem FlachdachWas steckt hinter dem kapitalintensiven Treibhaus-Projekt der "Urban Farmers"? Kann das funktionieren? Von Monika Jäggi Zuerst kamen die Gemeinschaftsgärten im "Landhof" und auf dem "Milchsuppe"-Areal, dann wurde Basel als Bienenstadt entdeckt. Bald werden Fische und Gemüse durch "Urban Farmers" auf Stadtdächern produziert. Die urbane Landwirtschaft wird um eine Facette reicher. Ein Überblick. Selber gepflanztes Gemüse aus dem Gemeinschaftsgarten des Verein "Urban Agriculture Basel" (UAB) oder Gurken und Forellen aus der kommerziell betriebenen Dachfarm der "Urban Farmers"? Bald haben Stadtbewohner die Wahl zwischen Nahrungsmittel, die im Gemeinschaftsgarten "Landhof" in der Erde wachsen, oder solchen, die mit der Aquaponic-Technik, im Wasser stehend, auf dem Dach gezogen werden. 21. Februar 2012
Vision Integrierte Dachfarmen
"Ich begreife vieles nicht" An und für sich habe ich nichts gegen urbane Dachgärten. Nur werden diese wohl nie den Wert eines Familiengarten erreichen. Man kann doch auch jetzt schon auf einem noch so kleinen Balkon Kräuter, Erdbeeren, Salat, Tomaten, Blumen u.s.w. pflanzen und später ernten. Nur, wieviele nehmen sich denn dafür überhaupt die Mühe?
Ich begreife aber vieles nicht. Zum Begegnungsort sollen diese Gärten werden. Für die jeweiligen Hausbewohner oder für jedermann? Wenn die Stadt schon jetzt für so viele zur Müllkippe geworden ist, wie wird es dann erst da oben? Jeden Tag 1-2 Stunden Arbeit müsste man investieren. Ob das eingehalten wird - oder ob es nach kurzer Zeit schon damit hapert? Wer wird die Fische artgerecht töten, ausnehmen, schuppen?
Und wenn doch bereits schon Sonnenkollektoren das Stadtbild beeinträchtigen sollen, wie wird denn da die Stadtbild-Kommission Freude an dieser Dächer-Landschaft haben? Dabei gäbe es ja wirklich nichts sinnvolleres als die tausenden Dächer für Strom ohne Atom zu nutzen. Und die Häuser jetzt schon zu begrünen, um die immer heisser werdenden Sommer in den Städten zu überleben. Heidi Gisi, Basel "Sicher auch für andere Städte von Interesse" Der OnlineReports-Artikel erklärt das Hydroponic/Aquaponic-System besser als alles Andere, was ich bisher darüber gelesen habe – einschliesslich der Website der "Urban Farmers". Das Urban Farmers System würde sicher auch für Städte in Ländern mit heissem Klima und Wassermangel von grossem Interesse sein. Alexander Radzyner, London "Warum denn Schrebergärten opfern?" Ich habe im Prinzip nichts gegen Urban Farming, grüne Dächer und ökologische Fischzuchten. Dennoch frage ich mich, warum man in Basel zahlreiche Schrebergärten dem hochpreisigen Wohnraum bzw. lukrativem Gewerbegebiet opfert und gleichzeitig 250'000 Franken aus dem CMS-Ertrag in das Projekt Lokdepot steckt, damit die "neuen Stadtlandschaften Begegnungs- und Bildungszentren werden und Stadtmenschen eine Naturerfahrung ermöglichen". Soweit ich das beurteilen kann, sind gerade Schrebergärten solche Orte. Christine Valentin, Basel "Spannend, kreativ und weltoffen" Städte werden die neuen Nationen sein. Und dieses Projekt ist ein wesentlicher Schritt in diese Richtung. Spannend, kreativ und weltoffen. Ich danke OnlineReports für diesen Artikel. Rolf Hermann, Schönenbuch |
Was Sie auch noch interessieren könnte
 |
Mit 99 jede Woche ins Turnen |
|||
 |
Vergänglichkeit wird zelebriert |
|||
 |
Letzte Saison unter Ivor Bolton |
|||
 |
vor Gewissens-Entscheid |
|||
 |
Reaktionen |

Ein Schweizer Vorzeige-Projekt:
20 Jahre "Obstgarten Farnsberg"
20 Jahre "Obstgarten Farnsberg"
Mit Birdlife-Projektleiter Jonas Schälle
unterwegs in einem Bijou der Biodiversität.

Reizfigur Sarah Regez:
Gefahr eines Absturzes
Gefahr eines Absturzes
Peter Knechtli über die Kontakte
der SVP-Politikerin zu Rechtsextremen.
 |
Reaktionen |

Hirnschlag mit 47: Die Geschichte von Patrick Moser
Der Baselbieter Lehrer und Journalist hat ein Buch über diesen Einschnitt geschrieben.

Kitas in Baselland: Personal und Eltern wandern in die Stadt ab
Eine Kita-Allianz will verhindern, dass die Situation noch prekärer wird.
 |
Reaktionen |

Permatrend muss nach
über 46 Jahren schliessen
über 46 Jahren schliessen
Mit dem Textildruck-Betrieb geht auch ein Stück Baselbieter Unternehmensgeschichte.

Regierung kontert den
Herr-im-Haus-Standpunkt
Herr-im-Haus-Standpunkt
Peter Knechtli zur Unterschutz-Stellung
der verwüsteten Sissacher Tschudy-Villa.
www.onlinereports.ch - Das unabhängige News-Portal der Nordwestschweiz
© Das Copyright sämtlicher auf dem Portal www.onlinereports.ch enthaltenen multimedialer Inhalte (Text, Bild, Audio, Video) liegt bei der OnlineReports GmbH sowie bei den Autorinnen und Autoren. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Veröffentlichungen jeder Art nur gegen Honorar und mit schriftlichem Einverständnis der Redaktion von OnlineReports.ch.
Die Redaktion bedingt hiermit jegliche Verantwortung und Haftung für Werbe-Banner oder andere Beiträge von Dritten oder einzelnen Autoren ab, die eigene Beiträge, wenn auch mit Zustimmung der Redaktion, auf der Plattform von OnlineReports publizieren. OnlineReports bemüht sich nach bestem Wissen und Gewissen darum, Urheber- und andere Rechte von Dritten durch ihre Publikationen nicht zu verletzen. Wer dennoch eine Verletzung derartiger Rechte auf OnlineReports feststellt, wird gebeten, die Redaktion umgehend zu informieren, damit die beanstandeten Inhalte unverzüglich entfernt werden können.
Auf dieser Website gibt es Links zu Websites Dritter. Sobald Sie diese anklicken, verlassen Sie unseren Einflussbereich. Für fremde Websites, zu welchen von dieser Website aus ein Link besteht, übernimmt OnlineReports keine inhaltliche oder rechtliche Verantwortung. Dasselbe gilt für Websites Dritter, die auf OnlineReports verlinken.






 Düngemittel für die Aufzucht der Nutzpflanzen verwendet. Diese filtern die Nitrate aus dem Wasser, das wieder zurück in das Fischbecken fliesst. Eine zusätzliche Düngung entfällt. Auf Pestizide und Fungizide wird verzichtet, ebenso auf Antibiotika.
Düngemittel für die Aufzucht der Nutzpflanzen verwendet. Diese filtern die Nitrate aus dem Wasser, das wieder zurück in das Fischbecken fliesst. Eine zusätzliche Düngung entfällt. Auf Pestizide und Fungizide wird verzichtet, ebenso auf Antibiotika. dass das Gebäude nicht verstärkt werden muss, das Dach also der massiven Belastung der Wassercontainer standhalten wird. "Allerdings wurden die Gelder unter der Bedingung gesprochen, dass die Restfinanzierung zustande kommt. Jetzt muss der Tatbeweis kommen." Die Abnehmer der Produkte werden Genossenschafter sein, so die Idee.
dass das Gebäude nicht verstärkt werden muss, das Dach also der massiven Belastung der Wassercontainer standhalten wird. "Allerdings wurden die Gelder unter der Bedingung gesprochen, dass die Restfinanzierung zustande kommt. Jetzt muss der Tatbeweis kommen." Die Abnehmer der Produkte werden Genossenschafter sein, so die Idee.