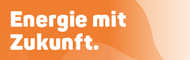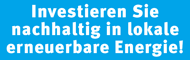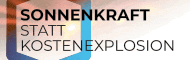Werbung

Claude Bühler – Premiere am Theater Basel
 Theater Basel, Kleine Bühne Uraufführung Bühne: Rocio Hernandez Kostüme: Viktoria Semperboni Komposition und Sounddesign: Diego Noguera Licht: Stefan Erny, Roland Heid Gast-Dramaturgie: Camilla Francisca Valladares Farru Dramaturgie: Kris Merken
Mit Elmira Bahrami, Marie Löcker, Gala Othero Winter
Eine Kooperation mit dem Theaterfestival Basel Die Apokalypse als PR-CoupMit dem Ende aller Dinge eröffnet das Theater Basel die Schauspielsaison: eine Apokalypse-Variation mit drei Frauen auf der Kleinen Bühne, die binnen zweier Stunden den Weltuntergang erwarten. Sie schlagen ihre verbleibende Zeit neurotisch, pathetisch, panisch, auch mit Spielereien tot. Vor lauter Aufregung kriegen die Drei, die in eigenwillig ältlichen Kostümen stecken, die an die Amish-People erinnern, kaum etwas auf die Reihe. Dem Publikum bieten sie mit überhasteten Dialogfetzen, kleinen Slapstick-Einlagen und kürzeren Nonsens-Exkursen einen kurzweiligen Einblick in ihre sperrigen Gemüter.
Gezeigt wird so eine Gesellschaft mit einer gewaltigen Zukunftsvision, aber ohne Gegenwartsgefühl, ohne Jetzt, ohne Mitte. Die chilenische Regisseurin und Autorin Manuela Infante findet einen doppeldeutigen Dreh für den Gag einer vorgezogenen, verfrühten, kunstvoll-verschroben ausgeführten Verbeugung der Frauen: Man wolle es jetzt "beenden". Gelächter und Applaus.
Aber in "Wie alles endet" erzählt Infante in ihrer ersten Basler Arbeit eben gerade nicht, wie wir alle sterben werden, sondern von der krankhaften Endzeit-Besessenheit, in der sie unsere Gesellschaft zunehmend gefangen sieht. Infante kritisiert das verbreitete, auch religiöse Untergangsfabulieren in unserer westlichen Welt, während wir zugleich die dringlichen Handlungen gegen Elend und Zerstörung aufschieben. "Die Apokalypse wird nicht kommen. Sie ist hier!", heisst es einmal im Text. Oder die sehnsüchtige Schlusszeile eines Tschechow-Stückes, "Nach Moskau", wird zitiert: Heisst, wir vertagen das Leben.
Infante mahnt nicht im Sinne eines Idealismus, sie denunziert, auch mit bitterbösem Sarkasmus. Dabei gelingt ihr in der Kernszene eine Verquickung zwischen der Manöverbesprechung eines Kollektivs und dem christlichen Abendmahl. Der "Bewegung", so die drei Aktivistinnen in beziehungsloser Geschäftigkeit, fehlte es an "Leadership" und "Followern", um sie auf "Weltmassstab" zu bringen. Mit ihrem "weissen" Mann (Jesus) sei kein Staat zu machen. Aber wenn der getötet würde, dann würde der – gestorben für eine angeblich grosse Sache - von "zero to hero", – wobei ein Mord natürlich mit den Bewegungs-Zielen von Liebe, Friede und sozialer Gerechtigkeit kollidierte.
Aber wenn man den Mann wieder auferstehen liesse (man versteckt ihn einfach), dann könnte man die Menschen mit dem Versprechen auf die Auferstehung zu einem Verhaltenskodex ("stehe früher auf, laufe, iss gesund, meditiere") verpflichten. Und das dramatische "Comeback", die Apokalypse, mit Weltkriegen, Ausserirdischen und Meteoriteneinschlägen, müsste man dann gar nicht selbst veranstalten. Man sagt einfach, "es kommt … in der Zukunft. Bald. Aber wir sagen nicht, wann".
Es ist die beste Szene des Abends: Clever vom Resultat her ausgedacht, dazu ausgefeilt dramatisiert. Aber tiefer werden die Hintergründe und Empfindungen nicht erforscht, die zur Geschichte eines solchen Endes führten und auch heute viele Millionen Menschen bewegt. Aber Infante setzt weitere Aspekte hinzu, etwa einen Exkurs zur Ernährung in der Höhlenzeit. Die Menschen hätten damals hauptsächlich Getreide gegessen. Die vielen Jagddarstellungen rührten allein daher, dass die Jagd viel mehr Abenteuer hergegeben hätte. Mehr noch: Die viele freie Zeit habe uns zu Fleischessern gemacht. Oder sie erinnert an die Verdauung, die im Gegensatz zu unserem linearen Zeitpfeildenken in Zyklen ohne Ziel abläuft.
Etwa ähnlich kann man sich die Dramaturgie denken, die nicht von A nach B durcherzählt, sondern die Erzählung wie ein Musikstück langsam in Loops und Kreisen weiterbewegt, und so nach und nach Klänge, stehende Bilder, Szenen, Geschichten, auch Ruhepunkte in ein Ganzes mischt. Nicht alles wird im Zusammenhang ganz verständlich, etwa die an sich starke Schilderung einer Frau im Gefängnis, die die Nahrung verweigert.
Das Stück sei in stundenlangen Improvisationen entwickelt worden. Das erlebt man. Elmira Bahrami, Marie Löcker, Gala Othero Winter wirken völlig aufeinander eingespielt und beweisen dabei komisches Talent. Was ihnen am Ende der 90 Minuten Aufführung wirklich wiederfährt, sei nicht verraten. Nur soviel: Es ist ziemlich vorhersehbar. 4. September 2022
|
www.onlinereports.ch
© Das Copyright sämtlicher auf dem Portal www.onlinereports.ch enthaltenen multimedialer Inhalte (Text, Bild, Audio, Video) liegt bei der OnlineReports GmbH sowie bei den Autorinnen und Autoren. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Veröffentlichungen jeder Art nur gegen Honorar und mit schriftlichem Einverständnis der Redaktion von OnlineReports.ch.
Die Redaktion bedingt hiermit jegliche Verantwortung und Haftung für Werbe-Banner oder andere Beiträge von Dritten oder einzelnen Autoren ab, die eigenen Beiträge, wenn auch mit Zustimmung der Redaktion, auf der Plattform von OnlineReports publizieren. OnlineReports bemüht sich nach bestem Wissen und Gewissen darum, Urheber- und andere Rechte von Dritten durch ihre Publikationen nicht zu verletzen. Wer dennoch eine Verletzung derartiger Rechte auf OnlineReports feststellt, wird gebeten, die Redaktion umgehend zu informieren, damit die beanstandeten Inhalte unverzüglich entfernt werden können.