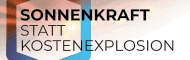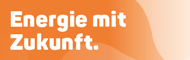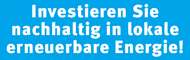Werbung

Claude Bühler – Premiere am Theater Basel
 Theater Basel, Schauspielhaus Uraufführung
Inszenierung und Text: Bonn Park Komposition: Ben Roessler Korrepetition: Nikolaus/Gracia Steinemann Bühne: Julia Nussbaumer Kostüme: Sina Manthey Licht: Vassilios Chassapakis Ton: Ralf Holtmann, Christof Stürchler Dramaturgie: Michael Gmaj
Mit Eva Bühnen, Fabian Dämmich, Lioba Kippe, Fabian Krüger und Dagobert
Chor: Flamur Blakaj, Jonathan Fink, Elena Marieke Gester vom Schauspielstudio Hochschule der Künste Bern
Barock-Ensemble: Louise Acabo, Karin Hannisdal, Giulia Manfredini, Sedipeh Nikoukar, Laura Esterina Pezzoli, Emma-Lisa Roux Kaukasische Männer, die reich sind und Pussy liebenWas ist Geld, wie bemisst sich sein Wert? Die einfache Kinderfrage kann uns mit Blick auf die Hintergründe der Börsengeschäfte arg in die Bredouille bringen. Endgültig rauscht uns aber der Kopf nach Bonn Parks 90-minütigem Basler Debüt, in dem er von der Kinderfrage ausgehend Finanztheorien in einer barocken Operette zu einem Mysterienspiel formt. Mit einem apokalyptischen Endkampf mahnt Park aktuelle Dringlichkeit an. Es sei absurd, dass kein Geld da sei, um den Planeten zu retten, heisst es im Bühnentext.
Park will aber nicht bloss finstere Kapitalismus-Kritik betreiben, sondern – durchaus heiter im Ton und streckenweise amüsant inszeniert – "von der Suche nach einer Utopie erzählen" (Programmheft). Eine Kernaussage: Wir müssten nur eine Pyjama-Party schmeissen, an der wir uns das Geld und seinen Wert als Fantasie vorstellten. Und in diese Vorstellung müssten wir natürlich Vertrauen haben.
Ähnlich kindlich stellt Park die Welt jener dar, die das Geld in Händen halten und die Weltordnung bestimmen. In einem Barock-Palais wuseln entsprechend gewandet und mit aus dickem Gold gekleisterten Perücken die Messieurs "Continental" oder "Vecteur" oder "La Vice" herum. Diese feudalen Leute, so der bestimmende Kniff des Abends, seien wir. "Kaukasische Männer, die reich sind und Pussy lieben", wie uns der Conférencier, der in deutschen Feuilletons gefeierte Schweizer Schlagerstar Dagobert, im Prolog cool mitteilt. Dass auch Frauen diese Männer verkörpern, soll zeigen, dass auch sie von dieser Identitätsvorstellung besetzt sind.
Das mit französischen Einsprengseln "Bubblés", "pensén" oder "achèten" geschraubte Deutsch, die Hermetik des Palais betonen eine exklusive, unerreichbare Kaste, in deren Reich zunehmend bedrohlich schwarzer Russ fällt. Es läuft nicht gut. Eben ist wieder eine Spekulationsblase geplatzt, die Aufregung ist gross, eine neue Idee muss her. Ein Kind soll sie bringen. Aber die Kinder seien eben nicht mehr Kinder, wie der in die Gesellschaft drängende elfjährige Ehrgeizling "Monsieur Débutant" erklärt. Sie hätten "Politik" statt Spielzeug, statt zu raufen perfektionierten sie eine Sprache aus Abkürzungen und Erniedrigungen.
Seine Idee, die Legende des Phönix aus der Währung, wird von den argwöhnischen Messieurs nicht verstanden. Hier interveniert Moderator "Dagobért", der sich als "Zeitreisender", als Zeremonienmeister entpuppt. Nach einem märchenhaften Exkurs über Federn in Schliessfächern mit geheimen Botschaften und magischen Fragen sagt er der Gesellschaft die Wahrheit, dass die Welt draussen immer schlimmer werde, mit "Einschusslöchern, Grad Celsius und Irre". Wir, die kaukasischen Männer, müssten alles verlieren und im Elend leben für immer. Dann gehe es dem Rest wunderbar.
Ein Deal, auf den sich die Messieurs offenbar einlassen. Und vom Bühnenhimmel herab senkt sich der übergrosse Phönixvogel, besiegt in tänzerischem Kampf das graue Ungeheuer des "verbrannten Geldes" aus der Unterwelt.
Diese Vergröberung kontrastiert mit sehr feinsinnigen Beobachtungen zum Zustand unserer Gesellschaft. Wie diese in nervöser Gier unsere Kindheit ausbeutet und aufsaugt, ist ein Treffer des Abends. Auch fabuliert Park gedankenschnell durch die Geschichte des Geldes, dessen zunehmenden Entsinnlichung in unserer Wahrnehmung, dessen Entwertung, wenn man gewohnt ist, es einfach zu haben. Tiefsinn mischt sich mit Albernheiten. Als Regisseur hat er aber seinen öfters wuchernden Text nicht immer glücklich gemeistert. Manche Monologe oder auch kurzgeschnittene Dialogpassagen flirren als Ideenfeuerwerk schnell gesprochen an einem vorüber, auch wenn sie Grundlegendes beeinhalten.
Als klärende Ruhepunkte wirken da die Pop-Songs, die das Barock-Ensemble live auf der Bühne intoniert. Sie verflüssigen die Aufführung und geben ihr Struktur, machen auch fühlbar, dass der Mensch mehr ist als die Karikatur, die er an dem geschwätzigen Abend verkörpert. Dass das Schauspiel-Ensemble sie nicht in Barockmanier singen kann, betont die Gebrochenheit der maroden Gesellschaft, aber auch, dass sie die Ausgeburt einer zwar blumigen, aber flüchtigen, teilweise infantilen Bühnenvision mit wenig Nachklang ist. 17. September 2022
|
www.onlinereports.ch
© Das Copyright sämtlicher auf dem Portal www.onlinereports.ch enthaltenen multimedialer Inhalte (Text, Bild, Audio, Video) liegt bei der OnlineReports GmbH sowie bei den Autorinnen und Autoren. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Veröffentlichungen jeder Art nur gegen Honorar und mit schriftlichem Einverständnis der Redaktion von OnlineReports.ch.
Die Redaktion bedingt hiermit jegliche Verantwortung und Haftung für Werbe-Banner oder andere Beiträge von Dritten oder einzelnen Autoren ab, die eigenen Beiträge, wenn auch mit Zustimmung der Redaktion, auf der Plattform von OnlineReports publizieren. OnlineReports bemüht sich nach bestem Wissen und Gewissen darum, Urheber- und andere Rechte von Dritten durch ihre Publikationen nicht zu verletzen. Wer dennoch eine Verletzung derartiger Rechte auf OnlineReports feststellt, wird gebeten, die Redaktion umgehend zu informieren, damit die beanstandeten Inhalte unverzüglich entfernt werden können.