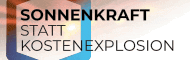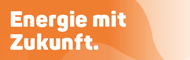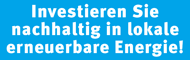Werbung

|
© Fotos by Ruedi Suter, OnlineReports.ch
 "Nie mehr die gleiche Welt": Kunstobjekt Atompilz
"Ein neuer nuklearer Genozid ist jederzeit möglich"60 Jahre nach "Hiroshima": Die Angst vor dem Terrorismus hat fatalerweise die Angst vor einem Nuklearkrieg verdrängt Von Ruedi Suter Der Schweizer Konfliktforscher Christian P. Scherrer rechnet jederzeit mit einem "neuen nuklearen Genozid". Heute vor 60 Jahren hat mit der Detonation von "Little Boy" über Hiroshima eine neue Zeitrechnung begonnen. Seither muss die Menschheit damit rechnen, Opfer der Atomindustrie zu werden. Viele Völker sind es heute schon. "Hiroshima" ist aktueller denn je: Versuch einer Standortbestimmung. Der in den Himmel wachsende Atompilz von Hiroshima: Er hat sich sogar in das Bewusstsein jener eingebrannt, die erst nach diesem Morgen des 6. August 1945 zur Welt kamen. Eingebrannt als schauerlich fesselndes Menetekel für eine vom Menschen organisierten Vernichtung unseres Planeten. "Wenn man mich nach dem wichtigsten Datum in der Geschichte und Vorgeschichte der Menschheit fragte, würde ich ohne Zögern den 6. August 1945 nennen", beginnt Arthur Köstler sein Buch "Der Mensch – Irrläufer der Evolution". Darin untersuchte der Journalist und Philosoph die Kluft zwischen unserem Denken und Handeln, zwischen Vernunft und Unvernunft.
Scherrer: "Die Atombomben explodierten über Japan, um der Sowjetunion eine eindrückliche Machtdemonstration zu liefern. Der Krieg gegen Japan war bereits gewonnen. Die Japaner versuchten zu kapitulieren, um den Kaiser zu retten, der später als oberster japanischer Kriegsverbrecher von den USA geschützt wurde. Amerika hat am 6. und 9. August 1945 die moralische Hemmschwelle der Menschheit überschritten. Dies mit dem Wissen seiner Wissenschaftler und Politiker: Sie wussten, dass die Welt nach dem nuklearen Genozid in Hiroshima-Nagasaki nie mehr die gleiche sein würde." 6. August 2005
"Forschung lehnt letztlich die Verantwortung für ihr Tun ab" Ruedi Suters Bericht weist uns wieder einmal eindrücklich darauf hin, wie die moderne Naturwissenschaft und ihre gutbezahlten Ausführenden an der "Forschungsfront" (wenn ich's nicht tue tut's ein anderer zuerst!) letztlich in der Regel jegliche moralische Verantwortung für ihr Tun ablehnen. Jede und jeder hat da seine Ausrede. Ständig wird um den heissen Brei herumgeredet. Vielleicht kommt von daher ein schöner Teil des heute weit verbreiteten Extremismus: Weil die Leute wieder mal Klartext und nicht Wischiwaschi hören wollen ("Deine Rede sei Ja, Ja, Nein, Nein, alles andere ist von Übel"). Am Eindrücklichsten hat diese "Unfassbarkeiten" (im doppelten Wortsinn) meiner Meinung nach der deutsche Dichter Eugen Roth (1895-1976) beschrieben:
"Ein Mensch - was noch ganz ungefährlich - Erklärt die Quanten (schwer erklärlich). Ein zweiter, der das All durchspäht, Erforscht die Relativität. Ein dritter nimmt, noch harmlos, an, Geheimnis stecke im Uran. Ein vierter ist nicht fernzuhalten Von dem Gedanken, kernzuspalten. Ein fünfter - reine Wissenschaft! - Entfesselt der Atome Kraft. Ein sechster, auch noch bonafidlich, Will die verwerten, doch nur friedlich. Unschuldig wirken sie zusammen: Wen dürften, einzeln, wir verdammen? Ist's nicht der siebte erst und achte, Der Bomben dachte und dann machte? Ist's nicht der Böseste der Bösen, Der's dann gewagt, sie auszulösen? Den Teufel wird man nie erwischen, Er steckt von Anfang an dazwischen." Dieter Stumpf, Basel "Einstein schlug den Bau einer Atombombe vor" Das Einstein-Jahr wird überall gefeiert. Zugleich jährt sich zum 60. Mal der Tag, an dem Atombomben sowohl über Hiroshima wie auch über Nagasaki abgeworfen wurden. Bei all dem Jubel über Einstein darf nicht vergessen werden, dass er es war, der in einem Brief an Roosevelt den Bau einer solchen Atombombe vorschlug. Das passt schlecht zum Bild des heute vermarkteten Einsteins als unkonventioneller Pazifist. Der Bombe fielen über eine halbe Million Menschen, grösstenteils Zivilisten, zum Opfer. Die Amerikaner wählten ihre Ziele mit Bedacht aus, nämlich Städte, in denen keine amerikanischen Kriegsgefangenenlager waren. Heute wird die nukleare Option von den USA wieder diskutiert. Nehmen wir den 60. Gedenktag für Hiroshima und Nagasaki zum Anlass, uns zu überlegen, was der Einsatz solcher Waffen bedeutet! Alexandra Nogawa, Basel |
Was Sie auch noch interessieren könnte
 |
vor Gewissens-Entscheid |
|||
 |
Reaktionen |

Erneuter Knall bei der SVP:
Riebli will Präsident werden
Riebli will Präsident werden
Caroline Mall zieht Kandidatur zugunsten des
68-jährigen Politikers aus Buckten zurück.
 |
Reaktionen |

Ein Schweizer Vorzeige-Projekt:
20 Jahre "Obstgarten Farnsberg"
20 Jahre "Obstgarten Farnsberg"
Mit Birdlife-Projektleiter Jonas Schälle
unterwegs in einem Bijou der Biodiversität.

SVP BL vor Scherbenhaufen:
Wie konnte es so weit kommen?
Wie konnte es so weit kommen?
Alessandra Paone über die Gründe, die zu
den Zerwürfnissen in der Partei geführt haben.
 |
Reaktionen |

Eskalation bei der SVP: Fraktionschef Riebli abgesetzt
Ab sofort leitet Reto Tschudin
die SVP-Fraktion im Baselbieter Landrat.
 |
Reaktionen |

Kantonsgericht Baselland:
Mitte droht leer auszugehen
Mitte droht leer auszugehen
Freisinn kann sich bei der Ersatzwahl dank
Taktik und Zufall einen Vorteil erhoffen.
 |
Reaktionen |

Regierungsrat Mustafa Atici muss die Kritik ernst nehmen
Kommentar von Jan Amsler und Alessandra Paone zur Regierungswahl in Basel-Stadt.

Mustafa Atici in die
Basler Regierung gewählt
Basler Regierung gewählt
Der SP-Kandidat ist der erste Kurde in einer Kantonsregierung – Cramer wird Präsident.

Reizfigur Sarah Regez:
Gefahr eines Absturzes
Gefahr eines Absturzes
Peter Knechtli über die Kontakte
der SVP-Politikerin zu Rechtsextremen.
 |
Reaktionen |

Dominik Straumann tritt als SVP-Präsident zurück
Vize Johannes Sutter soll übernehmen
und den Richtungsstreit beenden.
www.onlinereports.ch - Das unabhängige News-Portal der Nordwestschweiz
© Das Copyright sämtlicher auf dem Portal www.onlinereports.ch enthaltenen multimedialer Inhalte (Text, Bild, Audio, Video) liegt bei der OnlineReports GmbH sowie bei den Autorinnen und Autoren. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Veröffentlichungen jeder Art nur gegen Honorar und mit schriftlichem Einverständnis der Redaktion von OnlineReports.ch.
Die Redaktion bedingt hiermit jegliche Verantwortung und Haftung für Werbe-Banner oder andere Beiträge von Dritten oder einzelnen Autoren ab, die eigene Beiträge, wenn auch mit Zustimmung der Redaktion, auf der Plattform von OnlineReports publizieren. OnlineReports bemüht sich nach bestem Wissen und Gewissen darum, Urheber- und andere Rechte von Dritten durch ihre Publikationen nicht zu verletzen. Wer dennoch eine Verletzung derartiger Rechte auf OnlineReports feststellt, wird gebeten, die Redaktion umgehend zu informieren, damit die beanstandeten Inhalte unverzüglich entfernt werden können.
Auf dieser Website gibt es Links zu Websites Dritter. Sobald Sie diese anklicken, verlassen Sie unseren Einflussbereich. Für fremde Websites, zu welchen von dieser Website aus ein Link besteht, übernimmt OnlineReports keine inhaltliche oder rechtliche Verantwortung. Dasselbe gilt für Websites Dritter, die auf OnlineReports verlinken.






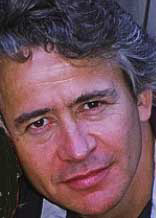 (HPI) der Universität von Hiroshima, spricht Klartext und vertritt die Auffassung, die USA hätten angesichts der gewaltigen Investitionen in das "Manhattan-Projekt" und nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor wohl unter jedem Vorwand eine Nuklearbombe in Japan getestet.
(HPI) der Universität von Hiroshima, spricht Klartext und vertritt die Auffassung, die USA hätten angesichts der gewaltigen Investitionen in das "Manhattan-Projekt" und nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor wohl unter jedem Vorwand eine Nuklearbombe in Japan getestet.