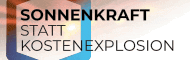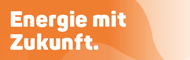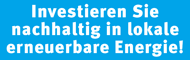Werbung

|
© Fotos by Ruedi Suter, OnlineReports.ch
 "Massiver Druck": Indioführer in Paraguay, von Fremden abgeholzter Urwald
Der Triumph der Umweltverachter über den UmweltjournalismusUmwelt-Rechercheure geraten immer häufiger ins Fadenkreuz von Staat und Privaten Von Ruedi Suter Umweltverachter profitieren von der Medienkrise: Über ihre Methoden, aber auch über die Komplexität, das Wachsen und die Folgen ökologischer Probleme wird immer weniger berichtet. Den Medienschaffenden fehlen für ihre Recherchen Finanzen und Publikationsmöglichkeiten. Folge: Die Umweltprobleme mit ihren Verheerungen in vorab armen Ländern bleiben abstrakt – und ungelöst. Sie ist stets schwierig, fast immer gefährlich, und manchmal auch tödlich: Die Berichterstattung über Umweltzerstörungen durch Staaten, Konzerne, Verbrechersyndikate, Grossgrundbesitzer, Siedler und bewaffnete Gruppen. Journalisten und Journalistinnen, die in den Machtzentren der Städte oder an Ort und Stelle in oft weit abgelegenen Gegenden Recherchen riskieren, werden vielfach behindert, eingeschüchtert, verfolgt und in den schlimmsten Fällen verletzt, zum Verschwinden gebracht oder getötet. Denn hinter den grossen und häufig nicht wieder gut zu machenden Umweltzerstörungen stehen stets handfeste wirtschaftliche Interessen.
Doch das Gegenteil ist der Fall: Die letzten Endes für das Überleben der ganzen Menschheit relevanten Themen, immer schon selektiv wahrgenommen, werden von den meisten der klassischen Medien nur noch bruchstückhaft, selten oder gar nicht mehr transportiert. Jene Medienleute aber, die für ihre Umweltrecherchen auch schon Mal Hals und Kopf riskieren, finden keine Abnehmer und damit auch kein Publikum mehr. Damit wird einer breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit genommen, sich auf reale Gefahren aus dem ökologischen Umfeld vorzubereiten und sich mental dagegen zu wappnen.
Fallbeispiel Giftmüll
Können Medienschaffende dennoch ihre heiklen Umweltberichte veröffentlichen, sind sie heute verwundbarer, weil potente Gegner sie mit gerichtlichen Klagen behindern können. In diese Richtung weist auch der aktuelle Fall des Giftmüllskandals bei Abidjan in der Elfenbeinküste, der laut verschiedenen Berichten rund ein Dutzend Menschen tötete, gegen 70 teils schwer erkranken liess und 108'000 Menschen zur ärztliche Behandlung zwang. Die für die Entsorgung des europäischen Giftmülls verantwortliche Trafigura bestreitete jede Schuld – und ging in die Gegenoffensive: Sie verklagte die recherchierenden Medienleute wegen Verleumdung.
Unterdessen ist aber das schweizerisch-niederländische Unternehmen zunehmend unter Druck geraten. Eine UNO-Untersuchung sieht einen Zusammenhang der Vergiftungen mit dem Giftmülltransport, Trafigura zahlte 2008 der Elfenbeinküste 150 Millionen Euro an die Lösung des Problems und rund 300 000 Klagenden wurde von der Firma eine Entschädigung zugestanden. Kürzlich fand Greenpeace schliesslich heraus, dass selbst der Chef des auch in Luzern beheimateten Rohstoffhandelkonzerns von der Gefährlichkeit der Ladung gewusst haben musste. Trafigura beharrt bis heute auf ihrer Unschuld. Der Fall zeigt exemplarisch, was für Dimensionen Umweltberichterstattungen erreichen können.
Die Wirklichkeit sieht anders aus
Eine weitere, für dem Umweltjournalismus bislang weniger hohe Hürde: Die spezialisierten Medienschaffenden können sich die in der Regel sehr aufwendigen Recherchen gar nicht mehr leisten. Das ist gravierend für alle, die an die Aufklärung und die Möglichkeit einer beherzten Änderung der Zustände glauben. Fatal auch für die Politik und die Allgemeinheit hierzulande – sie bekommen nicht mehr richtig mit, was ausserhalb ihres direkten Wahrnehmungsbereichs geschieht und was an Zukunftsbedrohungen auch auf sie zukommt. Praktisch ist dieser Zustand hingegen für Umweltsünder oder Umweltverbrecher. Und wunderbar für die Verschleierungstechniker in den PR-Agenturen, die so noch besser das eingeengte, nur von Eigeninteressen geprägte Weltbild ihrer mächtigen Auftraggeber verbreiten können.
Taub gegenüber tickende Umweltbomben
Was dort zutrifft, trifft um so mehr auf die vom Menschen losgetretenen Fehlentwicklungen in der noch ungleich komplexeren Welt der Ökologie zu. Geraten dort die für unser Dasein lebenswichtigen Faktoren ganz aus dem Tritt, wird uns die aktuelle Wirtschaftskrise dagegen wohl geradezu harmlos erscheinen. 6. Oktober 2009
"Das ist aufdeckender Journalismus" Das ist aufdeckender Journalismus. Eindrücklich, wichtig. Ich gratuliere. Ueli Mäder, Professor Institut für Soziologie, Basel |
Was Sie auch noch interessieren könnte
 |
20 Jahre "Obstgarten Farnsberg" |
|||
 |
neuen Ebenrain-Chef |
|||
 |
bei regionalen Strompreisen |
|||
 |
voller Tatendrang |
|||
 |
mit einer Million Franken |
|||
 |
Reaktionen |

Duell um den Ständerat:
Sven Inäbnit gegen Maya Graf
Sven Inäbnit gegen Maya Graf
Sie will die Pro-Kopf-Prämien abschaffen,
er auf keinen Fall. Das grosse Streitgespräch.
 |
Reaktionen |

Baselbieter GLP attackiert
rot-grüne Vertretung in Bern
rot-grüne Vertretung in Bern
Nach erfolgreichen Landratswahlen wollen die Grünliberalen auch einen Nationalratssitz.

Tiefgefrorene Tiere.
Und schmachtende Menschen
Und schmachtende Menschen
Das Museum.BL hat Probleme mit
Schädlingen und dem Sommer-Klima.

Paone und Amsler greifen
für Sie in die Tasten
für Sie in die Tasten
OnlineReports bleibt, was es ist.
Nur mehr davon.

25 Jahre OnlineReports:
Peter Knechtli sagt Adieu
Peter Knechtli sagt Adieu
pkn., der Gründer des Pionier-Newsportals,
übergibt jetzt die Verantwortung.
 |
Reaktionen |
www.onlinereports.ch - Das unabhängige News-Portal der Nordwestschweiz
© Das Copyright sämtlicher auf dem Portal www.onlinereports.ch enthaltenen multimedialer Inhalte (Text, Bild, Audio, Video) liegt bei der OnlineReports GmbH sowie bei den Autorinnen und Autoren. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Veröffentlichungen jeder Art nur gegen Honorar und mit schriftlichem Einverständnis der Redaktion von OnlineReports.ch.
Die Redaktion bedingt hiermit jegliche Verantwortung und Haftung für Werbe-Banner oder andere Beiträge von Dritten oder einzelnen Autoren ab, die eigene Beiträge, wenn auch mit Zustimmung der Redaktion, auf der Plattform von OnlineReports publizieren. OnlineReports bemüht sich nach bestem Wissen und Gewissen darum, Urheber- und andere Rechte von Dritten durch ihre Publikationen nicht zu verletzen. Wer dennoch eine Verletzung derartiger Rechte auf OnlineReports feststellt, wird gebeten, die Redaktion umgehend zu informieren, damit die beanstandeten Inhalte unverzüglich entfernt werden können.
Auf dieser Website gibt es Links zu Websites Dritter. Sobald Sie diese anklicken, verlassen Sie unseren Einflussbereich. Für fremde Websites, zu welchen von dieser Website aus ein Link besteht, übernimmt OnlineReports keine inhaltliche oder rechtliche Verantwortung. Dasselbe gilt für Websites Dritter, die auf OnlineReports verlinken.






 rende Schrott-Mafia seit langem schon als billige Sondermülldeponien für Konsumgesellschaften, Konzerne und Streitkräfte herhalten müssen, die versenkten Behälter rosten und die austretenden Giftstoffe für Fauna, Flora und Touristenstrände eine tödliche Gefahr bedeuten, scheint ebenso nebensächlich wie viele andere tickende Umweltbomben.
rende Schrott-Mafia seit langem schon als billige Sondermülldeponien für Konsumgesellschaften, Konzerne und Streitkräfte herhalten müssen, die versenkten Behälter rosten und die austretenden Giftstoffe für Fauna, Flora und Touristenstrände eine tödliche Gefahr bedeuten, scheint ebenso nebensächlich wie viele andere tickende Umweltbomben. geschrieben hatte, wurde er laut den Reportern ohne Grenzen im Juli 2009 wegen angeblicher "Verbreitung von Staatsgeheimnissen im Ausland" sowie "Verbreitung von Gerüchten" zu zwei Jahren "Umerziehung durch Arbeit" verurteilt.
geschrieben hatte, wurde er laut den Reportern ohne Grenzen im Juli 2009 wegen angeblicher "Verbreitung von Staatsgeheimnissen im Ausland" sowie "Verbreitung von Gerüchten" zu zwei Jahren "Umerziehung durch Arbeit" verurteilt.