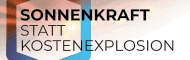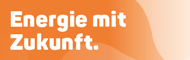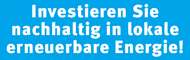© Fotos by Jari Hieskanen, Juha Taskinen, Ruedi Suter
"Eines der letzten Paradiese Europas": Saimaa-Süsswasser-Robbe
Gegen die Folgen der Klimaerwärmung ist auch ein Franz Weber chancenlos
Die 260 letzten Saimaa-Robben der Welt sind ein trauriges Symbol für das ungebremste Artensterben
Von Ruedi Suter
Die Wärmerwerden des Erdklimas setzt dem Umweltschutz unüberwindliche Grenzen. So wusste sich auch Franz Weber, bewährter Kämpe wider die Zerstörung der Natur, Mitte Juni in Finnland bei seiner Aktion zur Rettung der Saimaa-Ringelrobben erstmals nicht mehr zu helfen. Doch seine Impulse könnten wenigstens die faszinierende Seen-Landschaft vor Verschandelung und Exzessen der Tourismusindustrie bewahren. OnlineReports begleitete den neusten Feldzug des 83-Jährigen.
Lieber Gott! Mach, dass sich wenigstens eine blicken lässt! Egal wo – im Wasser, im Schilf oder auf einem der Uferfelsen. Bitte, wenigstens ein einziges Exemplar! Seit Stunden kreuzt das finnische Motorschiff «Velmeri» durch das Saimaa-Seengebiet. Seit Stunden suchen Kapitän und Crew mit Feldstechern diese grandiose Welt aus Wasser, Inseln und Wäldern ab. Und oben, auf dem Deck, ermattet die 16-köpfige Journalistenschar aus Frankreich und der Schweiz zusehends. Zuviel Sonne, zuviel Wind und zuviel unbelohnte Aufmerksamkeit. Nur die Fotografinnen halten weiterhin tapfer Ausschau nach dem Geschöpf, für das sie eine Woche ihres Arbeitslebens einzusetzen beschlossen haben. Aber die Wildnis ist kein Show-Event, ihre Lebewesen halten nichts von inszenierten Auftritten.
Auch Phoca hispida saimensis nicht. Die einzigartige Saimaa-Ringelrobbe ist scheu, ist selten und meistens unter Wasser. Um Luft zu holen, braucht sie nur alle 20 Minuten kurz aufzutauchen. Allein schon dies erschwert ihre Sichtung. Schade, denn aus dem sanftmütig blickenden Säugetier mit dem grossen Schnauzhaaren und den ringähnlichen Flecken auf dem Fell hat die Evolution eine Sensation gemacht: Die Robbe kann im Süsswasser leben. Ein Zeugnis gelungener Anpassung.
Abgeschnitten vom Meer
Ihre Vorfahren waren aus dem Meer, der Ostsee, in den Saimaa geschwommen. Nach der Eiszeit trocknete die Wasserverbindung im Südosten des heutigen Finnlands aus, Tausende der Ostsee-Robben waren nun vom Salzwasser abgeschnitten. Sie entwickelten sich im Saimaa mit seinen vielen miteinander verbundenen Seen zu "Süsswasser-Robben", wurden schliesslich gar zu einem Sinnbild für Finnlands unberührte Natur. Doch jetzt schweben beide in Gefahr, drohen beide zu verschwinden – die putzigen Flossenfüssler wie auch der Saimaa, eine der allerletzten Urlandschaften Europas.
Einem Mann konnte dieses Bedrohungsszenario nur schon von Berufes wegen nicht verborgen bleiben. Auch er ist auf dem Oberdeck, steht aufrecht an der Reling, einer Galionsfigur gleich. Sein Gesicht ähnelt dem eines alten Indianers, den viele Kämpfe gezeichnet haben. Der Wind zerrt an seiner weissen Haarpracht, ernst ist sein Blick in die Ferne gerichtet. Ein Bild der Entschlossenheit. Keine Frage, der Mann weiss von seiner Wirkung.
Aktivist mit 83 Jahren
Er ist selbst Journalist. Aber auch Schauspieler, Rebell, Poet, Kampagnenmacher – und Berufsretter bedrängter Tiere und bedrohter Landschaften. Ohne ihn hätte Europa einige seiner schönsten Landschaften und Kulturgüter verloren. Jetzt, im hohen Alter von 83 Jahren, ist der Basler Franz Weber, zu seinem neusten Feldzug aufgebrochen.
Er will die letzten Süsswasser-Robben retten, will dem finnischen Volk und Europa die Augen öffnen: Ein derart wertvoller Naturschatz wie die Seenregion des Saimaa gebe es kaum mehr sonst auf dem alten Kontinent. Schon einmal hat Weber eine Seenlandschaft gerettet, jene des Oberengadins. Und auch die Robben haben ihn nach 1977 nicht mehr ruhen lassen - seit diesem Aufsehen erregenden Einsatz mit dem französischen Filmstar Brigitte Bardot gegen das Totschlagen der Sattelrobben im kanadischen Packeis. Doch bei dieser Finnland-Offensive stellt sich dem Rettungs-Routinier erstmals ein übermächtiger Feind entgegen, gegen die seine bisherige Gegnerschaft aus profitfixierten Politikern, Baulöwen, Geschäftemachern und Tierfrevlern geradezu harmlos wirkt.
sonst auf dem alten Kontinent. Schon einmal hat Weber eine Seenlandschaft gerettet, jene des Oberengadins. Und auch die Robben haben ihn nach 1977 nicht mehr ruhen lassen - seit diesem Aufsehen erregenden Einsatz mit dem französischen Filmstar Brigitte Bardot gegen das Totschlagen der Sattelrobben im kanadischen Packeis. Doch bei dieser Finnland-Offensive stellt sich dem Rettungs-Routinier erstmals ein übermächtiger Feind entgegen, gegen die seine bisherige Gegnerschaft aus profitfixierten Politikern, Baulöwen, Geschäftemachern und Tierfrevlern geradezu harmlos wirkt.
Finnische Beistandsbitte
Das ahnte Franz Weber wohl schon vor seiner Einladung an die Journalist/innen, deren Reisekosten seine Fondation angesichts der serbelnden und für Umweltreportagen kaum mehr motivierbaren Medien vollumfänglich übernahm. Doch der Langzeitaktivist, für den es scheinbar auch im fortgeschrittenen Alter keine Aussichtslosigkeit gibt, wollte die Beistandsbitte finnischer Naturschützer nicht abweisen. Jetzt will er ihnen die notwendige Öffentlichkeit verschaffen: "Wenn wir keine Aufmerksamkeit erregen und keinen Druck machen, wird hier bald die letzte Robbe versenkt."
Dies seine Begründung gegenüber OnlineReports bei der Abfahrt aus dem Städtchen Savonlinna. So hat der streitbare Schweizer auch diesen Kampf aufgenommen. Trotz des Befehls seines Arztes, der ihn eines Hörsturzes wegen zu absoluter Ruhe verdonnerte. Und trotz der laufenden Fussball-Weltmeisterschaft, welche die globale Aufmerksamkeit exakt in die Gegenrichtung lenkt, nach Südafrika.
Erbarmungslose Jagd
"Wir sind dankbar, dass uns Mister Weber hilft: Es braucht den Druck von aussen, damit alle Finnen und die Regierung den wahren Wert dieser einzigartigen Seenlandschaft erkennen." Kaarina Tiainen ist Umweltwissenschaftlerin und Zoologin im Dienste der Robbenorganisation Suomen Luonnonsuojeluliitto. Während sie mit dem Fernglas das Ufer einer der mit Tannen und wenigen Birken bewachsenen Inseln absucht, schildert sie die Lage der Saimaa-Robben. Noch 1000 waren es vor 100 Jahren.
Weil die Fischfresser hin und wieder ein Baumwollnetz der Fischer zerrissen, wurden sie erbarmungslose gejagt. 1955 erfolgte ein Jagdverbot, doch dann setzte den überlebenden Raubtieren das Quecksilber zu, das die Holzindustrie ins Wasser spülte. Die Holzer seien heute jedoch auf dem Rückzug, und sie arbeiteten auch sauberer, sagt Tiainen.
260 Überlebende
Dennoch hat sie Angst um die Tierart. Eine echte Überlebenschance hätte diese, wenn noch 400 Süsswasser-Robben lebten. Aber es tummeln sich, inklusive Babies (Bild), nur noch etwa 260 Flossenfüssler im Saimaa. Allein in den letzten fünf Jahren schmolz der Tierbestand um 20 Individuen. Dies entspricht dem gesamten Artensterben auf der Welt: Die für gesunde Ökosysteme notwendige Artenvielfalt schrumpft dramatisch.
Tierbestand um 20 Individuen. Dies entspricht dem gesamten Artensterben auf der Welt: Die für gesunde Ökosysteme notwendige Artenvielfalt schrumpft dramatisch.
Gerade auch in den Binnengewässern, die rund zehn Prozent der weltweiten Fauna ausmachen. Laut dem UNO-Millenniumsziel hätte der Artenschwund bis dieses Jahr gestoppt werden müssen. Er geht aber ungebremst weiter – mit nicht absehbaren Folgen, auch für die Menschheit. Kaarina Tiainen nimmt das Fernglas vom Gesicht. Sie sagt: "Die Süsswasser-Robbe und ihre Situation ist auch ein Symbol für alle bedrohten Wildtiere."
Agonie im Kunststoffnetz
Es sind reissfeste Nylonnetze, welche heute die Saimaa-Robben dezimieren. Im Sommer ausgelegt von rund 10'000 Freizeitfischern, die nach der Schonzeit zwischen April und Juni ihre Netze zu wenig kontrollieren. Verfängt sich eine Robbe, ertrinkt sie jämmerlich. "Das traditionelle Hobbyfischen kann nicht einfach verboten werden", sagt jedoch Heli Järvinen. Denn mit Ausnahme der Nationalparks gehörten Land und Seen im 4'400 Quadratkilometer weiten Saimaa privaten Besitzern. Die Parlamentsabgeordnete der Grünen und Besitzerin eines der rund 14'000 Saimaa-Seen, schwört darum auf Überzeugungsarbeit, den freiwilligen Verzicht der Fischer auf die Netzfischerei und den Kauf von Gebieten zum Schutz der Artenvielfalt, die hier auch noch Tiere wie Elch, Bär, Wolf, Otter, Biber und Lachs umfasst.
Die Idee trägt Früchte. Auch deshalb, weil in Finnland – acht Mal so gross wie die Schweiz – die Natur vielen der 5,4 Millionen Einwohner/innen am Herzen liegt. Bereits 1'652 Quadratkilometer des Saimaa seien gekauft und nun private Schutzzonen, freut sich Politikerin Järvinen. Und Matti Partanen, ein Berufsfischer, ergänzt: "Wenn wir Profis eine Robbe im Netz haben, können wir sie sofort befreien. In den Netzen der Freizeitfischer aber haben sie keine Chance. Sichten wir eines dieser Netze, ziehen wir es ins Fischerboot. Wir möchten ja auch, dass unsere Robben überleben."
Aufgeheizte Winter
Ob die Zeit jedoch reiche, um so den Ringelrobben eine Zukunft zu sichern, bezweifelt Tiina Linsen. Auch sie hält nach den Raubtieren Ausschau und informiert. Die Robben vermehrten sich zu wenig und zu langsam, sagt die Nationalpark-Spezialistin. Doch die grösste Gefahr für das Überleben der Art sei "die neue Wärme". Linsen holt mit dem rechten Arm aus und zeigt auf das sogar trinkbare Wasser der Saimaa-Landschaft. Im Winter lägen hier sämtliche Seen unter einer 70 Zentimeter dicken Eisdecke, auf der die Robben Schneehöhlen für ihren Schutz und den Nachwuchs bauten. In einigen Wintern der letzten Zeit aber seien die schützenden Schneenester weggeschmolzen – keines der Robbenkinder überlebte. Kein Zweifel: Sie wurden Opfer des Klimawandels.
Auf Steuerbord plötzlich ein Schrei. "Dort, dort!" Merja Leppanen, Touristenführerin, hat in weiter Ferne im dunklen und vom Wind gepeitschten Wasser ein stecknadelkopfgrosses Etwas entdeckt. Der Blick durchs Fernglas schafft Gewissheit:  Es ist ein Robbenkopf, der mit grossen Augen neugierig zum Schiff herüberschaut – und dann gleich wieder abtaucht. Sie wird nicht näher kommen, sich nicht filmen und fotografieren lassen.
Es ist ein Robbenkopf, der mit grossen Augen neugierig zum Schiff herüberschaut – und dann gleich wieder abtaucht. Sie wird nicht näher kommen, sich nicht filmen und fotografieren lassen.
Und sie wird die letzte Robbe sein, welche Franz Weber und die Medienleute auf dieser Reise zu sehen bekommen. Dass der Trip wie von Weber erhofft auch keine fette Schlagzeile hergibt, wird auf der Rückreise klar. Den Finnen und Finninnen scheint die Not ihrer Saimaa-Robben weitgehend bewusst zu sein. Ihre Regierung hat sich gegenüber der EU in der Habitat-Direktive zum Schutz der Robben verpflichtet. Und auch die staatliche Naturschutzbehörde Metsähallitus, der WWF-Finnland, die Umweltagentur Süd Savo und die Universität Joensuu versuchen, das Überleben der Robben zu schützen.
Die neue Hilflosigkeit
Trotzdem hat Franz Weber das Gefühl, die Dringlichkeit des totalen Schutzes werde zu wenig erkannt. Es brauche mehr Tempo, mehr Entschlossenheit. Ein sofortiges Verbot der Freizeit-Netzfischerei und eine unbeschränkte Schonfrist etwa. Richtig gefolgert, bestätigen ihn Leute wie die Umweltwissenschaftlerin Tiainen oder der Saimaa-Forscher Topiantti Äikäs von der Universität Oulu. Doch gegen die tödlichen Folgen des Klimawandels sind alle rat- und hilflos.
Selbst Rettungsprofi Weber, der bislang immer nur gegen grundsätzlich bezwingbare Gegner gekämpft hat, weiss keinen Ausweg. So sieht sich der alte Haudegen in der finnischen Wildnis jählings mit der schmerzvollen Erfahrung bald aller Umweltschützer/innen konfrontiert: Gegen die Folgen der oft vom Menschen losgetretenen Umweltprobleme hilft des Zeitmangels und der ungeheuren Komplexität wegen nichts mehr. Es ist eine ähnliche Erfahrung der absoluten Hilflosigkeit, wie sie gerade eben auch im Golf von Mexico gemacht wird. Trotz aller bisheriger Rettungsversuche verwandelt sich der Ozean nach dem Absaufen der Ölplattform "Deep Horizon" seit Wochen in ein gigantisches Ölmeer mit unvorstellbaren Folgeschäden.
Angst vor den Russen
Die «Velmeri» nähert sich dem Hafen von Savonlinna. Am Ufer tauchen anstelle der traditionellen Holzhäuser ein paar hässlich gemauerte Neubauten auf. Sie lenken das Gespräch auf eine ganz andere Sorge der Bevölkerung Südostfinnlands: Auf das vier Stunden entfernte St. Petersburg und die russischen Nachbarn. Diese begännen sich in der Saimaa breitzumachen, als Angestellte, als Landkäufer, als Unternehmer, erklärt die Tourismusmanagerin Tuula Tegelberg. Der wachsende Einfluss der einstigen Kriegsgegner, versichert auch Parlamentarierin Järminen, fördere die Angst vor Bauspekulationen und der Zerstörung des Saimaa.
Gefahr droht aber auch vom Tourismus. Der versucht nun in die Lücke der abziehenden Holzindustrie zu springen, einfach um Arbeitsplätze zu sichern. Exakt dies ist nun – anders als das Wärmerwerden der Erde – wieder das Terrain, auf dem ein Franz Weber zu agieren versteht. Seine Fäuste fahren an die Schläfen, seine Augen funkeln, seine Stimme hebt sich: "Voyons, hier ist alles noch intakt. Die Saimaa-Seenlandschaft ist eines der letzten Paradiese Europas. Sie und ihre Robben müssen richtig geschützt werden. Sie darf keinesfalls verbaut werden wie die Landschaften um unsere Schweizer Seen!"
Begierdeobjekt der Tourismusindustrie
Der Vergleich mag hinken, aber Webers feines Gespür für verhängnisvolle Zukunftsentwicklungen darf nicht unterschätzt werden. Tatsächlich könnte sich der unsagbare Ruhe ausstrahlende Saimaa mit seinen einsamen Wald- und Wasseridyllen rasch zu einem neuen Begierdeobjekt der Tourismusindustrie entwickeln. Sollte die Weltwirtschaft wieder richtig Tritt fassen und den sich nach "unberührter Natur" sehnenden Stadtmenschen das Reisen weiterhin erleichtern, werden auch die letzten noch nicht genutzten Erholungsgebiete der Erde ins Visier der Reise- und Ferienkonzerne rücken.
Natur" sehnenden Stadtmenschen das Reisen weiterhin erleichtern, werden auch die letzten noch nicht genutzten Erholungsgebiete der Erde ins Visier der Reise- und Ferienkonzerne rücken.
Dass die Tourismusindustrie als eine der grössten Wachstumsbranchen in der Lage ist, sich selbst in schwer zugänglichen oder bislang kaum beachteten Gebieten festzukrallen, um für Einheimische und die Natur folgenschwere Veränderungen loszutreten, hat sie auf allen Kontinenten schon mehrfach bewiesen. Die Dimensionen dieser Gefahr, so dünkt es dem Schweizer Naturschützer folgerichtig, sei den mit riesigen Naturreserven gesegneten Finnen und Finninnen leider noch zu wenig bewusst.
Kauf einer Insel
So will Weber bald wiederkommen und seinen einheimischen Alliierten bei der Sensibilisierung der Bevölkerung mit entsprechender Publizität beistehen. Ziel ist eine rasche Bewusstseinserweiterung, ein mentaler Klimawandel sozusagen.
Um dies zu erreichen, versprach Landschaftsretter Weber, werde er beim nächsten Besuch auch eine möglichst von Robben belebte Saimaa-Insel mit Seestück erwerben – als bodenständiges Symbol schweizerischer Anteilnahme für die Erhaltung des begehrenswerten Seen-Labyrinths und seiner Ringelrobben.
Lieber Gott! Bitte mach, dass dort nie Kokospalmen wachsen werden!
28. Juni 2010
Weiterführende Links:





















 sonst auf dem alten Kontinent. Schon einmal hat Weber eine Seenlandschaft gerettet, jene des Oberengadins. Und auch die Robben haben ihn nach 1977 nicht mehr ruhen lassen - seit diesem Aufsehen erregenden Einsatz mit dem französischen Filmstar Brigitte Bardot gegen das Totschlagen der Sattelrobben im kanadischen Packeis. Doch bei dieser Finnland-Offensive stellt sich dem Rettungs-Routinier erstmals ein übermächtiger Feind entgegen, gegen die seine bisherige Gegnerschaft aus profitfixierten Politikern, Baulöwen, Geschäftemachern und Tierfrevlern geradezu harmlos wirkt.
sonst auf dem alten Kontinent. Schon einmal hat Weber eine Seenlandschaft gerettet, jene des Oberengadins. Und auch die Robben haben ihn nach 1977 nicht mehr ruhen lassen - seit diesem Aufsehen erregenden Einsatz mit dem französischen Filmstar Brigitte Bardot gegen das Totschlagen der Sattelrobben im kanadischen Packeis. Doch bei dieser Finnland-Offensive stellt sich dem Rettungs-Routinier erstmals ein übermächtiger Feind entgegen, gegen die seine bisherige Gegnerschaft aus profitfixierten Politikern, Baulöwen, Geschäftemachern und Tierfrevlern geradezu harmlos wirkt. Tierbestand um 20 Individuen. Dies entspricht dem gesamten Artensterben auf der Welt: Die für gesunde Ökosysteme notwendige Artenvielfalt schrumpft dramatisch.
Tierbestand um 20 Individuen. Dies entspricht dem gesamten Artensterben auf der Welt: Die für gesunde Ökosysteme notwendige Artenvielfalt schrumpft dramatisch. Es ist ein Robbenkopf, der mit grossen Augen neugierig zum Schiff herüberschaut – und dann gleich wieder abtaucht. Sie wird nicht näher kommen, sich nicht filmen und fotografieren lassen.
Es ist ein Robbenkopf, der mit grossen Augen neugierig zum Schiff herüberschaut – und dann gleich wieder abtaucht. Sie wird nicht näher kommen, sich nicht filmen und fotografieren lassen. Natur" sehnenden Stadtmenschen das Reisen weiterhin erleichtern, werden auch die letzten noch nicht genutzten Erholungsgebiete der Erde ins Visier der Reise- und Ferienkonzerne rücken.
Natur" sehnenden Stadtmenschen das Reisen weiterhin erleichtern, werden auch die letzten noch nicht genutzten Erholungsgebiete der Erde ins Visier der Reise- und Ferienkonzerne rücken.