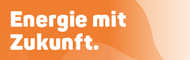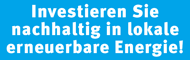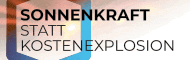Werbung

|
© Foto by WWF
 "Nicht das Anprangern zum Ziel": Umweltschützer Claude Martin
"Zielsicherheit und Durchhaltewillen sind entscheidend"WWF-Stratege Claude Martin über den Zustand der Erde, staatliche Heuchelei und den Öko-Fundamentalismus Von Ruedi Suter Als Generaldirektor des WWF International war der Schweizer Claude Martin zwölf Jahre lang einer der mächtigsten Umweltschützer der Welt. In seiner Amtszeit hat sich die Panda-Organisation bei Regierungen und Konzernen Respekt verschafft. Kritiker meinen demgegenüber, der WWF sei heute zu oft Steigbügelhalter der Mächtigen. Ein Gespräch mit Claude Martin, der morgen Freitag am Natur-Kongress in Basel mit UNEP-Generaldirektor Klaus Töpfer und Bundesrat Moritz Leuenberger auftreten wird. OnlineReports: Claude Martin, was haben Sie für eine Beziehung zur Humanisten- und Chemiestadt Basel?
"Mit Vorverurteilungen vergibt man sich oft OnlineReports: Wir bitten um eine Selbsteinschätzung: Was haben Sie und Ihr WWF-Team seit Ihrem Amtsantritt international ändern können? Was sind die grössten Erfolge der "Aera Martin"?
"Wir wollen letztlich daran gemessen werden, OnlineReports: Kritiker des WWF, worunter engagierte UmweltschützerInnen und MenschenrechtlerInnen, vertreten folgende Meinung: Der WWF hat sich mit seiner zu diplomatischen Haltung zum Feigenblatt der Globalisierung entwickelt. Weil er auch skrupellose und uneinsichtige Umweltsünder nicht vehement an den Pranger stelle und damit auch der Umweltzerstörung keinen Riegel schiebe. Ihre Entgegnung?
"Uns wirft man vor, wir prophezeiten OnlineReports: Der WWF handelt nach dem Prinzip der Hoffnung. Er handelt, als könne alles noch geändert und gerettet werden. Ist das nicht Zweckoptimismus? Wäre es nicht klüger, dieses Prinzip als erster Umweltkonzern einmal grundsätzlich in Frage zu stellen und den Leuten zu sagen: "Hört, es ist bereits 5 nach 12 Uhr. Das Einzige, was wir noch tun können, ist, das Erhaltene zu bewahren und uns auf eine äusserst schwierige und trostlose Zukunft vorzubereiten"?
"Keine Oekonomie kann ohne nachhaltige OnlineReports: Und wie sollen wir uns als Individuen verhalten? 23. Februar 2006
DER GESPRÄCHSPARTNER
Claude Martin wurde 1945 in Zürich geboren. Der Schweizer studierte Biologie und kam in den frühen siebzigerer Jahren zum WWF. Zunächst arbeitete er für Feldprojekte in Indien und Afrika, bevor er 1980 CEO des WWF Schweiz wurde. Unter seiner Leitung entwickelte sich der Schweizer Zweig zu einer der führenden Umweltschutz-Organisationen im Land und einem der stärksten Glieder im WWF-Netzwerk. Als Generaldirektor von WWF International (1993 - 2005) suchte Martin nach neuen Ansätzen im internationalen Umweltschutz. Er setzte sich unter anderem für eine zielgerichtete Umweltschutzpolitik und die Bildung internationale Partnerschaften ein, zum Beispiel für die "Allianz zum Schutz des Waldes" zwischen WWF und Weltbank, dem Amazonas-Schutzzonen-Programm (Amazon Region Protected Areas Plan) und Partnerschaften mit Wirtschaft und Industrie. Während seiner Amtszeit war der WWF an der Gründung des Weltforstrats (Forest Stewardship Council, FSC) und des Marine Stewardship Council (MSC) beteiligt. Ende 2005 übergab Martin die Generaldirektion an den amerikanischen Umweltjuristen James P. Leape (50). Claude Martin vertritt den WWF weiterhin in Beratungsgremien auf höchster Ebene. Zudem hilft er beim Aufbau eines Freiwilligen-Netzwerks, damit junge Menschen in WWF-Projekten praktische Erfahrung im Umweltschutz sammeln können. "Nur Heftpflaster für den sterbenden Patienten Erde" Mit grossem Interesse habe ich Ruedi Suters Interview mit Claude Martin gelesen. Es gibt wohl keinen Zweifel, dass in den letzten 20 Jahren mehr natürliche Lebensgrundlagen in Mitleidenschaft gezogen oder zerstört worden sind als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Der WWF gilt als die finanziell am besten unterstützte Umweltschutzorganisation. Nicht zuletzt auch darum, weil er von Grossunternehmen und Regierungen mitfinanziert werde, die ein umweltschützerisches Feigenblatt oft dringend nötig haben. So verkauft der WWF an vorderster Front das, was ich als "Heftpflaster-Umweltschutz" bezeichne.
Der Patient Erde stirbt an Krebs, wenn ihm nicht mit einer radikalen Bestrahlungstherapie geholfen wird. Die meisten Menschen akzeptieren diese Diagnose solange nicht, als die grossen Umweltorganisationen die "Zauberdoktoren" spielen und gegen eine Spende versprechen, den Krebs zu heilen. Diese Ausgangslage passt allen ganz gut.
Die Spender - inbegriffen die Grosskonzerne, Institutionen und Regierungen - können sagen, sie hätten ihren Teil zur Rettung der Natur beigetragen, und die Umweltschutzorganisationen können ihren Direktoren wie Claude Martin grosszügige Löhne auszahlen, den Wagenpark mit neuen Geländewagen bestücken und natürlich auch im zentralen Afrikas einige Urwaldparks gründen, deren Gebiete meinen Erfahrungen nach oft bereits abgeholzt wurden. Ein weiteres Heftpflaster für den tödlich erkrankten Patienten.
Dabei wäre gerade ein Top-Umweltschützer vom Format eines Claude Martin in der Lage, der Augenwischerei ein Ende zu setzen und zu erklären: "Hört Leute, unsere Methoden in den letzten 30 Jahre haben kläglich versagt. Es ist Zeit zu überlegen, ob unsere Bestrahlungstherapie nicht vielleicht grundlegend geändert werden müsste." Doch dies wäre sehr schmerzhaft, sehr kostspielig und erst noch keine Garantie, dass es anders funktionieren würde. Aber weiterhin so zu tun, als würde der "Heftpflaster-Umweltschutz" die Welt retten können, ist auch keine Lösung. Im Gegenteil, die "Heftpflaster-Politik" bleibt das grosse Hindernis - für eine effektive Bewahrung unserer Natur.
Diese bräuchte höchstwahrscheinlich ein radikales Umdenken. Das aber würde aus jedem Öko-Pragmatiker einen "Öko-Fundamentalisten" machen, wie Claude Martin WWF-Kritiker aus der Umwelt- und Menschenrechtszene nennt. Das grösste Problem ist, dass das Establishment - bestehend aus den Konzernen, den kurzsichtigen Regierungen und den grossen Umweltschutzorganisationen - vor langer Zeit schon beschlossen hat, den Öko-Fundamentalismus zu verdammen und dafür den viel lukrativeren Ökopragmatismus hochzuhalten.
Wenn also die abgetretenen Direktoren von Umweltkonzernen - wie viele andere vor Claude Martin - das Spiel weiterspielen wollen, um von einträglichen Beraterjobs profitieren zu können. Dann werden sie wohl weiter den "Ökopragmatismus" predigen müssen. Und der sterbende Patient bekommt weiterhin nur Heftpflaster verpasst. Karl Ammann, Nanyuki, Kenya |
Was Sie auch noch interessieren könnte
 |
20 Jahre "Obstgarten Farnsberg" |
|||
 |
neuen Ebenrain-Chef |
|||
 |
bei regionalen Strompreisen |
|||
 |
voller Tatendrang |
|||
 |
mit einer Million Franken |
|||
 |
Reaktionen |

Duell um den Ständerat:
Sven Inäbnit gegen Maya Graf
Sven Inäbnit gegen Maya Graf
Sie will die Pro-Kopf-Prämien abschaffen,
er auf keinen Fall. Das grosse Streitgespräch.
 |
Reaktionen |

Baselbieter GLP attackiert
rot-grüne Vertretung in Bern
rot-grüne Vertretung in Bern
Nach erfolgreichen Landratswahlen wollen die Grünliberalen auch einen Nationalratssitz.

Tiefgefrorene Tiere.
Und schmachtende Menschen
Und schmachtende Menschen
Das Museum.BL hat Probleme mit
Schädlingen und dem Sommer-Klima.

Paone und Amsler greifen
für Sie in die Tasten
für Sie in die Tasten
OnlineReports bleibt, was es ist.
Nur mehr davon.

25 Jahre OnlineReports:
Peter Knechtli sagt Adieu
Peter Knechtli sagt Adieu
pkn., der Gründer des Pionier-Newsportals,
übergibt jetzt die Verantwortung.
 |
Reaktionen |
www.onlinereports.ch - Das unabhängige News-Portal der Nordwestschweiz
© Das Copyright sämtlicher auf dem Portal www.onlinereports.ch enthaltenen multimedialer Inhalte (Text, Bild, Audio, Video) liegt bei der OnlineReports GmbH sowie bei den Autorinnen und Autoren. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Veröffentlichungen jeder Art nur gegen Honorar und mit schriftlichem Einverständnis der Redaktion von OnlineReports.ch.
Die Redaktion bedingt hiermit jegliche Verantwortung und Haftung für Werbe-Banner oder andere Beiträge von Dritten oder einzelnen Autoren ab, die eigene Beiträge, wenn auch mit Zustimmung der Redaktion, auf der Plattform von OnlineReports publizieren. OnlineReports bemüht sich nach bestem Wissen und Gewissen darum, Urheber- und andere Rechte von Dritten durch ihre Publikationen nicht zu verletzen. Wer dennoch eine Verletzung derartiger Rechte auf OnlineReports feststellt, wird gebeten, die Redaktion umgehend zu informieren, damit die beanstandeten Inhalte unverzüglich entfernt werden können.
Auf dieser Website gibt es Links zu Websites Dritter. Sobald Sie diese anklicken, verlassen Sie unseren Einflussbereich. Für fremde Websites, zu welchen von dieser Website aus ein Link besteht, übernimmt OnlineReports keine inhaltliche oder rechtliche Verantwortung. Dasselbe gilt für Websites Dritter, die auf OnlineReports verlinken.