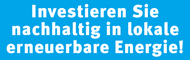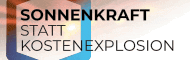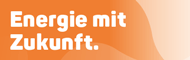Strompreise: Was machen die Zürcher besser?
Was sind schon zehn Franken! Zwei Caffe Latte. Also, scheinbar, kaum der Rede wert.
Zehn Franken – das ist laut einer regierungsrätlichen Mitteilung auch der Mehrpreis, den ein Basler "Muster-Haushalt" ab 2009 für die Elektrizität bezahlen muss – dies allerdings monatlich. Der Regierungsrat tröstet: "In den meisten Haushalten lässt sich diese Mehrbelastung mit einfachen Massnahmen wie dem Einsatz von Energiesparlampen (...) kompensieren."
Da wir bereits viele Glühbirnen durch Sparlampen ersetzt haben, vergleichen wir heute nicht die Lampenpreise, sondern die Tarifpolitik der Elektrizitätswerke. Schliesslich haben die Tarife nicht nur einen Einfluss auf die Stromrechnung der Haushalte; weil höhere Energiepreise auch die heimische Produktion von Waren und Dienstleistungen verteuern, darf jede Familie noch ein paar Zehnernötli drauflegen. Alles in allem werden die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten über eine halbe Milliarde Franken zu begleichen haben – über die Stromrechnung, über den Brotpreis, über das Zugbillett. Jahr für Jahr. Denn diese Summe kassiert die Elektrizitätswirtschaft ab 2009 zusätzlich ein – ohne wirklich eine Mehrleistung erbringen zu müssen. Eine halbbatzige Strommarktöffnung, ein neues Gesetz und eine zahnlose staatliche Aufsicht machen diesen Raubzug auf das Portemonnaie der Konsumenten möglich.
Besonders krass ist die Preiserhöhung in Basel. Um satte 23 Prozent steigen hier die Tarife für den Strom. Die örtliche Politik nickt es weitgehend ab. Die Bürgerlichen, weil sie aus wirtschaftspolitischer Überzeugung für die Liberalisierung waren. Die Linken und Grünen, weil sie aus ökologischen Überlegungen für höhere Energiepreise sind.
Die Preisaufschläge werden überall gleich begründet – auch in Basel: Man verweist auf neue, gesetzlich geforderte Abgaben. Vor allem aber schiebt man den Schwarzen Peter auf die Swissgrid, die neu gegründete nationale Netzgesellschaft, die nunmehr das Schweizer Hochspannungsnetz betreibt und den Elektrizitätswerken für die Stromdurchleitung überrissene Preise in Rechnung stellt. Die Swissgrid-Gebühr sei "eine Zumutung für die Basler Stromverbraucher", schimpft der neue IWB-Chef David Thiel in OnlineReports. Seine Verärgerung ist verständlich. Die IWB mussten bisher für die gleiche Leistung rund 25 Millionen Franken weniger entrichten.
Wie aber ist es möglich, dass unter diesen neuen Voraussetzungen in Basel die Strompreise um über 20 Prozent steigen, während sie in der Stadt Zürich nicht nur gleich bleiben, sondern während drei Jahren gar um 15 Prozent sinken? Beide Städte sind rot-grün regiert. Beide Städte unterhalten eigene Elektrizitätswerke. Beide Städte propagieren das Stromsparen, den energiepolitischen Wandel. Und beide Städte verrechnen heute ungefähr die gleichen Strompreise.
Schauen wir genauer hin. In Basel liefern die Industriellen Werke Basel (IWB) den Strom. Die IWB sind ein Gemischtwarenladen: Sie handeln mit Elektrizität, mit Wasser, mit Fernwärme, mit Gas, mit Telekommunikation. Sie erwirtschaften einen jährlichen Gesamtumsatz von über einer halben Milliarde Franken. Doch wirklich rentabel ist derzeit nur das Stromgeschäft. In dieser Sparte erzielten die IWB im 2007 bei einem Umsatz von 183 Millionen Franken einen Gewinn von 24 Millionen.
Ihren Strom beziehen die IWB zu fast 90 Prozent aus Wasserkraft; an einigen Kraftwerken halten sie Beteiligungen. Kein einziges Watt beziehen die IWB aus den Schweizer Atomkraftwerken. Die Basler Energielücke wird vor allem über europäische Handelsbörsen gedeckt. Hier jedoch sind die Preise gestiegen.
Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) ist grösser. Es handelt fast ausschliesslich mit Energie und macht damit rund 665 Millionen Franken Umsatz. Das EWZ ist ein kerngesundes Unternehmen. Es muss keine defizitäre Wasserversorgung mittragen und keine Geothermie-Experimente decken. So hat es ein beachtliches Vermögen angehäuft, das allein schon rund 19 Millionen Franken als Finanzertrag in die Kasse spült. Insgesamt lieferte das EWZ im Jahr 2007 einen Gewinn von über 62 Millionen Franken an die Stadt ab.
Das EWZ ist strategisch clever aufgestellt. Es deckt die ganze Wertschöpfungskette von der Produktion über die Verteilung bis zum Handel ab. Es betreibt eigene Kraftwerke und produziert damit mehr Strom, als es für die Versorgung braucht. Und trotz der Absicht, längerfristig auf Atomstrom verzichten zu wollen, hält das EWZ nach wie vor eine Beteiligung am Kernkraftwerk Gösgen. Was immer in der Schweizer Energiepolitik geschieht – das Zürcher Werk bleibt gut verkabelt.
So hat es zum Beispiel sein eigenes Hochspannungsnetz gegen eine 12-Prozent-Beteiligung in die Swissgrid eingebracht. Damit kann das EWZ der neuen Tarifordnung gelassen entgegenblicken. Denn, Ironie des Schicksals: Auch die Basler Stromverbraucher finanzieren über die hohen Swissgrid-Gebühren indirekt das EWZ. Die Zürcher können es sich deshalb leisten, neue Abgaben wie die Gebühr zur Förderung von erneuerbaren Energien nicht an die Kunden zu verrechnen, während die IWB ihren Kunden nun sogar die öffentliche Beleuchtung separat in Rechnung stellen müssen.
Die rot-grüne Stadtzürcher Energiepolitik ist zwar pragmatisch, aus Basler Sicht wohl zu pragmatisch. Aber sie ist erfolgreich.
15. September 2008