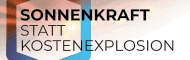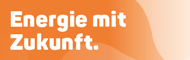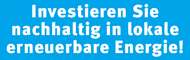Der ewige Streit um die Stadtentwicklung in Basel
Basel hat erneut über ein städtebauliches Grossprojekt abgestimmt: Diesmal über den "Koloss" am Messeplatz. Und für einmal hat die Bevölkerung Ja gesagt – Ja zum neuen Messezentrum, Ja zur Neugestaltung des öffentlichen Raums.
Ist das nun gut? Ist es schlecht? Das soll hier nicht das Thema sein. Wir gehen statt dessen in den Messeturm, fahren 31 Stockwerke hoch, werfen einen Blick aufs Schlachtgelände und lassen die Gedanken kreisen. Ein schöner Flecken Erde, diese Stadt, alles gut überschaubar. Mittendrin die verwinkelte Altstadt, dicht daneben die Industriebauten. Rundherum Wohn- und Geschäftsquartiere. Ein eng begrenzter städtischer Raum in einer offenen, reizvollen Landschaft. Viel Nähe, viel Weite.
Fahrstuhl runter auf den Messeplatz. Was waren hier schon wieder die Argumente? Ach ja, man sprach von Dachkanten und Schattenwürfen, von Baukosten und Wertschöpfungen. Letztlich aber ging es um das Bild, das man hat von dieser Stadt: Ist Basel eine grosse Kleinstadt oder eine kleine Grossstadt? An dieser Frage reibt man sich. Basel ist nicht nur das Eine, nicht nur das Andere; die Stadt ist beides ein Bisschen.
Basel werde zur Provinz, drohten die Befürworter des Neubaus für den Fall, dass die Vorlage abgelehnt werde. Die Gegner sahen im Projekt hingegen einen Ausdruck ortsfremder Gigantomanie. Die gleichen Schreckensbilder malte man bereits beim Projekt für ein Grosskino an der Heuwaage oder bei der Abstimmung über ein neues Stadt-Casino am Barfüsserplatz. Pulsierende Grosstadt oder wohnliche Kleinstadt? Wirtschaftliche Potenzsteigerung oder politischer Muskelschwund? Dieser ewige Streit der beiden Basel in Basel: Er manifestiert eine seltsame Unzufriedenheit über die städtische Leistung und Entwicklung, ein Hadern und Jammern auf hohem Niveau.
Objektiv betrachtet besteht nämlich wenig Grund zur Klage, weder von dieser noch von jener Seite. Im Gegenteil: Die Stadt lebt alles in allem sehr gut mit ihren inneren Widersprüchen. Sie hat sich in den letzten Jahren wirtschaftlich dynamisch entwickelt und ist trotzdem wohnlich geblieben, sogar wohnlicher geworden. Auch die Staatsfinanzen sind wieder im Gleichgewicht. Befördert vielleicht das Eine das Andere? Braucht es den Hang zum Kleinstädtischen, um den pulsierenden Wirtschaftsstandort als attraktiven Lebens- und Wohnort zu erhalten? Und macht umgekehrt die Internationalität des Forschungs- und Werkplatzes diese Stadt erst richtig vielfältig und vital?
Demnächst werden einige Zehntausend Besucherinnen und Besucher der Fussball-EM nach Basel reisen. Manche erwarten wohl den Charme einer "Chemiestadt". Sie werden eine überraschend schöne Host City entdecken, vor allem auch jenseits der "Carlsberg"-Zone.
Denn Basel hat es in den letzten Jahren geschafft, die Attraktivität der Stadt mit vielen gezielten, auch kleineren Massnahmen zu steigern. Man hat neue Begegnungsstätten geschaffen, ganze Strassenzüge saniert, Parkanlagen neu gestaltet. Damit sind zwar nicht die Bausünden früherer Jahrzehnte getilgt. Doch die Stadt ist wohnlicher und lebendiger geworden.
Was war der Schlüssel zum Erfolg? Er steckt in der Erkenntnis, dass es den Dialog mit der Bevölkerung braucht. Er steckt im Bemühen von Regierung und Verwaltung, die Ideen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen, aufzugreifen und – wo möglich – in den Stadtentwicklungsprozess zu integrieren. Der seinerzeitige Dialogprozess "Werkstadt Basel", der dem heutigen "Aktionsprogramm Stadtentwicklung Basel" zu Grunde liegt, ist zwar da und dort belächelt worden, war zeitraubend und hat auch Leerläufe und Enttäuschungen produziert. Letztlich aber hat sich die Bürgerbeteiligung gelohnt. Sie hat nicht nur zu einer höheren Akzeptanz vieler Projekte geführt, sondern ganz generell zu einem Plus an städtischer Wohn- und Lebensqualität.
Man sollte sich dies auch für künftige Projekte in Erinnerung bewahren.
2. Juni 2008
"Mauern befanden sich nie in Basler Köpfen"
Man stelle sich mal vor, Basel sei nicht von politischen Grenzen eingeschlossen. Und nur gerade die stimmberechtigten Menschen, die "downtown" leben, hätten was zu sagen, wenn in der Stadtmitte etwas geplant würde. Alle, die in den Aussenquartieren leben, hätten nur etwas zu melden, wenn ihr Quartier betroffen wäre.
Nun – Basel ist umringt von politischen Grenzen und bleibt somit eine kleine Stadt. Gleichzeitig aber bleibt halt auch der grösste Teil Basels "downtown" – nicht nur das geografische, sondern auch kulturelle und wirtschaftliche Zentrum einer sehr viel grösseren Stadt, als sie es politisch sein darf. Eines Zentrums, das erst noch eine bedeutende Fläche für eine äusserst attraktive Altstadt möglichst unberührt sein lässt.
Dass die Bewohner von Basel das wissen und sich der speziellen Verantwortung bewusst sind, wie das die Abstimmung vom vergangenen Wochenende beweist, ehrt sie. Es wäre ja so viel leichter, die "Aussenquartiere" und die dort lebenden Menschen und ihre wirtschaftliche Lebensgrundlage einfach wegzudenken, um Schattenwürfe zu verhindern. Zumal ja leider jene Menschen dort allzu oft auch sehr egoistisch die "downtown" lebenden Menschen einfach alle Zentrumslasten alleine tragen lassen.
Man hätte ja – von mir aus – die Stadtmauern stehen lassen können. Aber zum Glück für uns alle, sind die Mauern in den Köpfen der Basler nie da gewesen. So soll es auch bleiben.
Peter Waldner, Basel