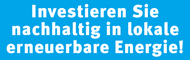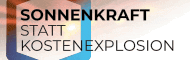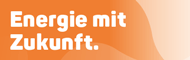© Fotos by Monika Jäggi
"Euphorisches Verhalten": Pflanzblätz in Torontos Seaton Village
Bienenstöcke im Finanzzentrum, Hennen im Hinterhof
Nachhaltige Stadtentwicklung am Beispiel Toronto: Die Bevölkerung ist verrückt nach Bienen, Hühnern, Gemüse und Obstbäumen
Von Monika Jäggi
Zu einer Vorzeigestadt bezüglich Förderung der städtischen Landwirtschaft hat sich in den letzten Jahren Toronto entwickelt: In der grössten Wirtschaftsmetropole Kanadas wird Stadthonig zu einem Verkaufsschlager und glückliche Hühner lernen den urbanen Lifestyle kennen.
Die Aufregung um die Bienen erreichte diesen Frühsommer in Toronto einen Höhepunkt, als das neue Opernhaus, das "Four Seasons Centre of the Performing Arts", zwei Bienenstöcke auf seinem Flachdach installierte. Damit wagte das Opernhaus, was nicht nur auf dem Operhaus in Paris und auf Londons berühmten Kaufhaus Fortnum and Mason schon Realität ist, sondern seit drei Jahren auch auf dem Dach des "Fairmont Royal York Hotels".
Dort, im Nutzgarten des berühmtesten Stadthotels, produzieren sechs Bienenstöcke mit über 300'000 Bienen rund 365 Kilogramm Honig pro Jahr für den Eigenbedarf. Was als Pilotprojekt im Kräuter- und Blumengarten auf der 14. Etage begann, ist heute ein Erfolg. Der Honig des "Fairmont Royal York" gilt als Delikatesse. Ausserdem verkauft sich der Honig im hoteleigenen Souvenirshop wunderbar als Mitbringsel und sorgt überdies als Nischenprodukt für einen speziellen PR-Effekt.
Zwischen Wolkenkratzern und Strassenschluchten
Das Aussergewöhliche an diesen beiden Standorten: Sie liegen auf Flachdächern in schwindelerregender Höhe und mitten in der Stadt, umgeben von Wolkenkratzern und Strassenschluchten. Trotz dieser einmaligen Lage gilt die Qualität des Stadthonigs als besonders gut, denn die Bienen suchen sich den Nektar innerhalb eines Radius von fünf bis sechs Kilometern rund um Hotel und vom Opernhaus. Sie bestäuben dadurch tausende von Blüten in der Innenstadt, in Stadtparks oder auf der vorgelagerten Toronto Island. Dort finden sie ein vielfältigeres Angebot vor, als auf den intensiv genutzten Landwirtschaftsflächen ausserhalb der Stadt. Nicht umsonst wird Toronto auch die "Stadt im Park" genannt.
Aber nicht nur auf Hotel- und Opernhausdächern finden Bienenstöcke eine neue Heimat. Obwohl das Halten von Bienen in privaten Innenstadtgärten illegal ist, nimmt der Anteil der Imker, die Bienenstöcke auf Balkonen oder in den Stadtgärten Gastrecht geben, rapide zu.
Die lokale Imker-Genossenschaft ("Bee-Keepers Co-operative") lässt verlauten, dass immer mehr Interessierte der Genossenschaft beitreten, um als Volontäre auszuhelfen und um den richtigen Umgang mit Bienen zu lernen. Weil das Interesse derart gross ist, ist die Genossenschaft nun auf der Suche nach einem geeigneten Standort in der Innenstadt, um ein Lernzentrum für den Umgang mit Honigbienen zu errichten.
Behördlich geduldete Verbotszone
Genauso euphorisch wie bei den Bienen verhalten sich die Torontonier auch in Bezug auf die private, aber ebenso verbotene Hühnerhaltung in ihren Hausgärten in der Stadt. In zahlreichen Zeitungsartikeln und in prominenten Radioshows werden Pro- und Contra-Diskussionen zu dieser Form von Hühnerhaltung geführt. Dabei schwingen die Befürwortenden obenauf: "Es macht mehr Sinn, die Hühner im eigenen Garten zu holen, anstatt mit dem Auto zum Supermarkt zu fahren, um Eier zu kaufen, die von einer Farm weit ausserhalb der Stadt kommen",  erklärt Alice, die ihren richtigen Namen in der Radioshow aus Angst um ihre Hühner nicht preisgeben will. "Ausserdem weiss ich, womit sie gefüttert wurden und dass sie gesund sind."
erklärt Alice, die ihren richtigen Namen in der Radioshow aus Angst um ihre Hühner nicht preisgeben will. "Ausserdem weiss ich, womit sie gefüttert wurden und dass sie gesund sind."
Mit dieser Einstellung ist Alice nicht alleine. Denn für urbane Farmer wie sie steht die Frage nach den "food miles" – wieviele Meilen hat ein Nahrungsmittel von der Produktion bis zur Verkaufsstätte zurückgelegt und wie wurde es hergestellt und verarbeitet – sowie der Gesundheitsaspekt gekaufter Nahrungsmittel immer mehr im Vordergrund. Und so tauchen immer mehr Torontonier in die behördlich geduldete Verbotszone ab, um sich ihre eigenen Hennen zu halten.
Hühnerhaltung wird Wahlkampf-Thema
Sympathien für die Nutztiere werden nämlich auch in der Stadtregierung gehegt. Denn die Frage nach der Legalisierung der Hühnerhaltung wird mittlerweile auch zu einem Thema in den Bürgermeisterwahlen vom kommenden Herbst. Bereits zirkuliert eine Petition zur Aufhebung des Verbots auf dem Internet. Und Joe Pantalone, Stadtrat und Vize-Bürgermeister und selber Kandidat für das Bürgermeisteramt, sieht die urbane Farm mitsamt Hühnerhaltung als Teil einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Mit einer Legalisierung würde Toronto mit anderen Weltstädten wie Vancouver oder auch mit New York City gleichziehen.
Die Hühner- und Bienenhaltungsdiskussion ist Teil einer städtischen Bewegung, die Toronto, aber auch andere Städte Kanadas und der USA erfasst hat. Sie ist Ausdruck eines wachsenden Unbehagens der Gesellschaft gegenüber ihrem eigenen Essverhalten, der globalisierten industrialisierten Nahrungsmittelherstellung, aber auch gegenüber den hohen Sozial- und Umweltkosten und den Kosten für die Gesundheit.
Neue Äcker braucht die Stadt
Das Unbehagen zeigt sich auch in der Energie und Überzeugung, mit der die Torontonier dabei sind, die Innenstadt in eine Gemüse- und Obstfarm zu verwandeln: Was kann, so ihre Frage, lokaler sein für den Gemüse- und Früchteanbau als der eigene Garten?
Was für Schweizer Städte vorerst noch abenteurlich anmutet, nimmt in Toronto schnell Formen an. Eine Fahrt mit dem Fahrrad durch das Seaton Village, einem Trendquartier in der Innenstadt, ze igt denn auch Erstaunliches: Anstelle von gepflegten Gärtchen finden sich hinter, neben und vor den Häusern Reihen von Gemüsebeeten und mittendrin Birnen-, Äpfel- oder Kirschenbäume. Aber auch Blumengärten werden angelegt, in zahlreichen Gärten finden sich Menschen, die jäten, umgraben und pflanzen.
igt denn auch Erstaunliches: Anstelle von gepflegten Gärtchen finden sich hinter, neben und vor den Häusern Reihen von Gemüsebeeten und mittendrin Birnen-, Äpfel- oder Kirschenbäume. Aber auch Blumengärten werden angelegt, in zahlreichen Gärten finden sich Menschen, die jäten, umgraben und pflanzen.
Unterstützten die mit Tomaten, Bohnen, Trauben und Kürbissen dicht bepflanzten Gärten vor und hinter dem Haus bis vor kurzem vorwiegend die aus dem Mittelmeerraum oder aus China stammenden Immigrantenfamilien, sind heute auch Torontonier daran, ihre Gärten neu zu bestellen. So finden sich auch weiter nördlich in Richtung Yorkville, der "Bahnhofstrasse" Torontos, nicht nur in den Gärten Zeichen der Selbstversorgung, sondern auch ein regelrechter Garten-Boulevard (Bild): Gemüsebeete anstelle von Parkplätzen.
Lokale Nahrungsmittelstrategie für Toronto
Die urbane Landwirtschaft hat das Potential, die Nahrungsmittelversorgung einer Grosstadt und deren Selbstversorgung bis zu einem gewissen Grad zu unterstützen. Das anerkennt die Stadt Toronto mit ihrer am 1. Juni vorgestellen offiziellen Nahrungsmittel-Strategie ("Toronto Food Strategy"): Ein Aktionsplan zeigt, wie die zukünftige Ernährung der Stadtbevölkerung und das wirtschaftliche Überleben der regionalen Familien-Bauernbetriebe sichergestellt werden sollen. Die Strategie wird damit begründet, dass die sozialen, ökologischen und gesundheitlichen Kosten der industriellen Nahrungsmittelproduktion heute zu hoch sind.
So beeinträchtigen Billignahrungsmittel-Importe nicht nur die Gesundheit sozial weniger gut gestellter Bevölkerungsschichten. Sie ruinieren auch die Familienbauernbetriebe in Südontario, beschleunigen den Ausverkauf des besten landwirtschaftlichen Bodens für den Bau neuer Wohngebiete und tragen so zur Zersiedlung Südontarios bei.
Ein wichtiges Ziel der Nahrungsmittel-Strategie ist es aber auch, unabhängiger von Importen zu werden. Denn 60 Prozent des Bedarfs stammen aus Florida, Kalifornien und Chile. Einwohner sollen die Möglichkeit haben, auf ein lokales und regionales Versorgungsnetz zurückgreifen zu können. Eine Massnahme, um dem Trend der Verstädterung entgegen zu wirken, ist die Unterstützung der gefährdeten Familienbetriebe durch die Konsumenten in der Stadt. In einem Pilotprojekt regte die Stadtregierung beispielsweise die Verwaltung und die stadteigenen Institutionen an, ihre Nahrungsmittel aus regionalen und lokalen Quellen zu beziehen. Die Strategie scheint zu greifen. Heute bezieht Toronto bereits 25 Prozent ihrer Nahrungsmittel-Einkäufe aus Südontario.
Gärten in die Stadtplanung integrieren
Um die Landwirtschaft in der Stadt zu fördern, sieht der Aktionsplan unter anderem die Schaffung von sogenannten lebensmittelfreundlichen Quartieren ("food-friendly neighbourhoods") vor. Quartiere werden aufgewertet, indem der Anbau, das Angebot und der Verkauf von lokalen oder regionalen Lebensmitteln unterstützt und vereinfacht wird.
Darunter fällt zum Beispiel die Schaffung von Gemeinschaftsgärten, die Unterstützung von wöchentlich stattfindenden Bauernmärkten oder die Begrünung von Flachdächern mit Nutzgärten. Insbesondere sollen neue Quartiere so geplant werden, dass die Einkaufsmöglichkeiten, die wöchentliche Märkte oder Gemeinschaftsgärten zu Fuss erreichbar werden. Die raumplanerische Grundlage für diese und andere Massnahmen wurde im Offiziellen Plan der Stadt Toronto - vergleichbar mit dem Politikplan der Stadt Basel - 2002 gelegt und in der Revision von 2007 erweitert.
Lieber im Garten als im Stau
Die wöchentliche Fahrt ins Wochenendhaus am See war bisher eine sakrosankte torontonische Tradition. Wie die kanadische Tageszeitung "The Globe and Mail" im Juni meldete, ziehen es jedoch mehr und mehr Städter vor, das Wochenende in ihrem Garten und im sozialen Kontakt mit den Nachbarn zu verbringen, als die stundenlange Staufahrt an die Seen in Kauf zu nehmen.
Urbane Landwirtschaft bietet also auch einen sozialen Anreiz, um das Freizeit-Mobilitätsverhalten zu überdenken und zu verändern.
Monika Jäggi ist promovierte Geographin und Journalistin. Sie lebt in Basel und in Toronto. In Toronto bewirtschaftet sie ihren eigenen Gemüse- und Obstgarten.
1. September 2010
Weiterführende Links:
Basel: Noch widersprüchliche Absichten
mj. Auch in Basel sind die Stadtentwickler, aber auch die Stadtgärtner nicht untätig. Allerdings widersprechen sich oftmals noch die Ansichten. Während die einen grau statt grün vorschlagen, wünscht sich die andere Seite grün statt grau. So bei der "Landhof"-Abstimmung im Frühjahr, bei der sich eine Mehrheit der Bevökerung ein grünes Areal statt eine familienfreundliche Überbauung wünschte, oder bei der aktuellen Zonenplanrevision. Diese sieht vor, bis ins Jahr 2030 20 Prozent der rund 6'000 Familiengärten zu überbauen. Davon ist unter anderem auch das "Milchsuppe"-Areal mit seinen tausend Anwohnern und Pächtern betroffen. Mit einer Sammel-Einsprache wehren sich Betroffene gegen die in der Zonenplanrevision geplante Überbauung.
Während sich bei diesen beiden Beispielen die Betroffenen noch für die Freihaltung von Flächen einsetzen, handelt der im Frühjahr gegründete Verein "Urban AgriCulture Netz Basel" (UANB). Mit praktischen Projekten setzt sich der Verein ein für "eine Stadt mit Landwirtschaft". So beispielsweise mit dem Projekt "Essbare Siedlung". Ziel ist es, Nutzgärten in Siedlungsnähe und mit Hilfe der Stadtbewohner anzubauen.
Das Projekt steckt noch in den Anfängen, die angefragten Leute und Organisationen seien jedoch begeistert von der Idee, erklärt Tilla Künzle, Initiantin des Projektes. Weitere Projekte sind das Projekt "NutzDach", das die Begrünung von Flachdächern mit Nutzgärten fördern will, oder das Projekt "Stadthonig". Andreas Seiler, der Projektleiter von "Stadthonig" betreut mittlerweile drei Bienenvölker in der Stadt, die dieses Jahr bereits 50 Kilogramm Honig produziert haben. Und auch das Dach des "Gundeldingerfelds" beherbergt seit Juli zwei Bienenvölker.






















 erklärt Alice, die ihren richtigen Namen in der Radioshow aus Angst um ihre Hühner nicht preisgeben will. "Ausserdem weiss ich, womit sie gefüttert wurden und dass sie gesund sind."
erklärt Alice, die ihren richtigen Namen in der Radioshow aus Angst um ihre Hühner nicht preisgeben will. "Ausserdem weiss ich, womit sie gefüttert wurden und dass sie gesund sind."  igt denn auch Erstaunliches: Anstelle von gepflegten Gärtchen finden sich hinter, neben und vor den Häusern Reihen von Gemüsebeeten und mittendrin Birnen-, Äpfel- oder Kirschenbäume. Aber auch Blumengärten werden angelegt, in zahlreichen Gärten finden sich Menschen, die jäten, umgraben und pflanzen.
igt denn auch Erstaunliches: Anstelle von gepflegten Gärtchen finden sich hinter, neben und vor den Häusern Reihen von Gemüsebeeten und mittendrin Birnen-, Äpfel- oder Kirschenbäume. Aber auch Blumengärten werden angelegt, in zahlreichen Gärten finden sich Menschen, die jäten, umgraben und pflanzen.