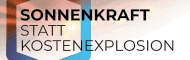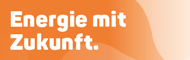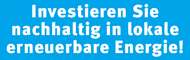Bekenntnisse einer Quotenfrau
Schweizer Quotenfrau? Gibt's doch noch gar nicht.
Stimmt, aber von 1986 bis 2002 gab es "Taten statt Worte", was ein Projekt war, bei dem sich die teilnehmenden Unternehmen verpflichteten, Kaderpositionen wenn möglich mit Frauen zu besetzen. Und ich war so eine gute "Tat".
Damals waren die meisten Akademiker männlich, und die wenigen Juristinnen zog es meist zu den sogenannten Frauenthemen wie Familienrecht und Scheidungen – etwas, was mich nie interessierte. Und so bewarb ich mich in der Wirtschaft. Und gewann das Schaulaufen um die offene Stelle dank XX-Chromosomen-Konstellation ganz ohne Anstrengung. Ich aber war sauer. Zum einen fand ich dies den männlichen Bewerbern gegenüber ungerecht, und zum andern war es höchst unbefriedigend. Denn eine Stelle kraft Geschlechts zu kriegen, ist ebenso herabsetzend, wie das Gegenteil. Ausschlaggebend sollte das Können sein, nicht Haarfarbe oder Schuhgrösse oder Geschlecht.
Ebenfalls stinksauer war mein direkter Vorgesetzter. Er hatte einen andern Kandidaten vorgezogen, und dass der meinetwegen nicht eingestellt wurde, nahm er mir übel. Zudem: eine Frau – wie peinlich! Nur wenn es unumgänglich war, stellte er mich vor, und dann mit knallrotem Kopf. Was ihm natürlich spöttische Bemerkungen einbrachte. Mit einem Chef, der mehr Gegner als Kollege war, wurde die Sache zum Spiessrutenlauf, und als sich ihm die Gelegenheit bot – der zweite Schwangerschaftsurlaub – stellte er mich vor die Türe, am ersten Tag nach Ablauf des Mutterschutzes, morgens um 08:00. "Taten statt Worte".
"Es gibt genug ausgebildete Frauen.
Wir sind heute keine spezie rara mehr."
Angestellt zu werden aus einem Grund, der nichts mit den Anforderungen an die beruflichen Fähigkeiten zu tun hat, ist unfair. Es muss ein jeder, eine jede das Recht haben, aus rein sachlichen, objektiven und mit dem Beruf in direktem Zusammenhang stehenden Gründen eingestellt zu werden. Es braucht die Akzeptanz im Team. Die Chemie zwischen den Kollegen muss stimmen. Nur dann kann produktiv gearbeitet werden. Wer stur Frauenquoten für das obere Kader verlangt, hat keine Ahnung, was das für Betroffene heisst. Wir haben heute genug gut ausgebildete Frauen, wir sind keine spezie rara mehr. Wenn es heute weniger Frauen als Männer im oberen Kader hat, dann hat dies andere Gründe.
So verlockend wie für Männer ist der Gipfel der Karriere für uns Frauen nämlich nicht, und zwar aus Gründen der sozialen Akzeptanz. Wer als Mann beruflich ganz oben angekommen ist, ist auch sozial der Hirsch, wird von den andern Männern bewundert und von der Damenwelt angehimmelt. Und kommt er mit einer dreissig Jahre jüngeren, weiblichen Begleitung an einen Anlass – erste Ehe mit Kindern geschieden – wird er noch mehr bewundert. Und zu den Ehrengästen platziert.
Sehen Sie eine Frau in dieser Situation? Die Männer bewundern sie so wenig, wie die Frauen sie anhimmeln. Eher wird ihr Neid und Misstrauen entgegengebracht. Und kommt sie mit einem dreissig Jahre jüngeren, männlichen Begleiter an einen Anlass, kann sie froh sein, wenn sie nicht in der Küche essen muss. Der soziale Anreiz, alles für die Karriere zu tun, fehlt uns Frauen. Wenn wir auf den Karrierezug aufspringen, dann nur, weil uns der Job gefällt. Im Gegensatz zu den Hausmännern erfahren dafür wir soziale Akzeptanz, wenn wir Mütter sind und uns, voll- oder teilzeitig, um Kinder kümmern.
Das kann sich ändern. Deshalb ist es wichtig, die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familie zu fördern. Es soll jeder und jede sein oder ihr berufliches und privates Leben so organisieren können, wie es für ihn oder sie richtig ist. Zufriedene Menschen sind zufriedene Berufsleute und zufriedene Eltern.
Berufstätigkeit und Karriere sind aber zweierlei. Der Preis für eine Karriere ist hoch, Wochenendarbeit, Reisen, Ferienabbrüche und Umzüge sind an der Tagesordnung. Es ist deshalb möglich, dass es der Spitze immer an Frauen fehlen wird, weil die sich dazu weniger motivieren lassen. Möglich, dass sich in Zukunft aber auch weniger Männer so einspannen lassen. Das wären dann wirklich Taten statt Worte.
4. Februar 2013
"Mir war egal Quotenfrau gewesen zu sein"
Interessant, wie Angehörige verschiedener Generationen offenbar anders damit umgehen, "Quotenfrau" gewesen zu sein. Mit Jahrgang 1934 war ich immer mal wieder die erste oder die einzige Frau in einem Gremium. Manchmal aufgrund geschriebener oder ungeschriebener "Quoten". Das war mir egal. Wenn ich nur meinen Einflussbereich erweitern konnte!
Mit anderen zusammen habe ich mich vehement für die Einsitznahme von Frauen in Gremien eingesetzt. Auch mit dem Quotenargument, ob es nun vorgeschrieben oder von uns nur reklamiert war. Ganz klar war aber für uns, dass wir nur geeignete Frauen vorschlugen und unterstützten. Darüber mussten wir nicht einmal sprechen. Das ist ja auch bei den Männern so. Wenn noch "einer von der Gewerkschaft", "ein Romand", "ein Wissenschafter" in einem Gremium benötigt wird, gehen wir selbstverständlich davon aus, dass uns geeignete Leute vorgeschlagen werden.
Der Quotenmann par excellence war für mich Bundesrat Flavio Cotti. Er war "der Tessiner Bundesrat". Hat er sich je darüber beklagt? Nein, er hat sich gefreut und dafür gesorgt, dass sich auch die Tessiner in der Landesregierung wieder einmal vertreten fühlen konnten.
Gleiches könnten wir von unseren Romands im Bundesrat sagen. Unsere Gesellschaft besteht aus vielen Gremien, die nach einem irgendwie gearteten Proporz (nach irgendwelchen Quoten) zusammengesetzt sind. Quoten dienen dazu, Entwicklungen vorwärts zu treiben wie bei Frauenquoten oder Minderheiten angemessen zu berücksichtigen wie bei der Vertretung der Sprachregionen.
Quotenfrau zu sein oder gewesen zu sein, ist für mich kein Makel sondern der Hinweis darauf, dass es verschiedene Mittel und Wege gibt, Gerechtigkeit herzustellen.
Judith Stamm, Luzern