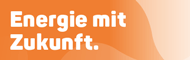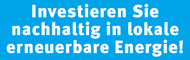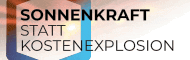Werbung

|
© Foto by Museumsdienste Basel-Stadt
 "Acht Stunden sind schnell vorbei": Museumsnacht 2007
Zwei Fahrpläne für eine NachtEin Stadtfest für die Kultur: Am 18. Januar ist in Basel Museumsnacht Von Aurel Schmidt Wieder ist in Basel Museumsnacht: Für den Besuch der 32 teilnehmenden Museen und acht Gastinstitutionen werden 21'000 Besucher erwartet. Ein vielfältiges kulturelles Programm mit Workshops, Theater- und Cabaretaufführungen, musikalischen Darbietungen und gastronomischen Angeboten ist für sie vorbereitet. Museumsnacht! Museumsnacht! Und ganz Basel ist auf den Beinen. Warum nicht? Die Museumsnacht ist fast so etwas wie ein Stadtfest. Der kulturelle Hintergrund vermischt sich mit einer gesellschaftlichen Erwartung. Und damit, sagen wir es offen heraus, beginnen auch schon die Probleme. 10. Januar 2008
Basler Museumsvielfalt: Zwei Beispiele
• Das Pharmazie-Historische Museum im "Haus zum Vorderen Sessel" am Totengässlein 3 ist aus der 1924 gegründeten privaten Sammlung von Josef Anton Häfliger, Apotheker und Professor an der Uni, hervorgegangen. Ein Glücksfall: Der private Charme ist erhalten geblieben: Das Pharmazie-Museum ist auch ein Museums über das Museum. Unter anderem vermitteln die szenografische Nachbildung einer Alchemistenküche und eines Labors sowie die Übernahme der historischen Hofapotheke Innsbruck einen verräumlichten Eindruck des Arzneiwesens, das sich von alten, magischen Vorstellungen und alchemistischen Praktiken über die Herstellung von Medikamenten aus Pflanzen und Mineralien in Destilliergeräten, Mörsern und Standgefässen bis zum Beginn der pharmazeutischen Industrie entwickelt. |
Was Sie auch noch interessieren könnte
 |
Vergänglichkeit wird zelebriert |
|||
 |
Letzte Saison unter Ivor Bolton |
|||
 |
unter Denkmalschutz |
|||
 |
Auch musikalisch eine Grosstat |
|||
 |
Reaktionen |

"Carmen" als Stellvertreterin
der unterdrückten Frauen
der unterdrückten Frauen
Das Theater Basel stülpt Bizets Oper eine politische Botschaft über.

Stiftungsgeld rettet
Verein Kosmos Space
Verein Kosmos Space
Krise beim Senioren-Projekt auf dem Bruderholz: Vorstand trat in corpore zurück.

20 Jahre Joker in
Sissach – mit demselben Wirt
Sissach – mit demselben Wirt
Didi Wanner hat mit seinem Nachtlokal viele andere Clubs in der Region überlebt.

Eltern und Kinder irritiert:
Warum ist das Karussell stumm?
Warum ist das Karussell stumm?
Der langjährige Konflikt um den Münsterplatz nimmt absurde Züge an.
 |
Reaktionen |

152 Tage und weiterhin
voller Tatendrang
voller Tatendrang
Jan Amsler und Alessandra Paone geben Einblick in ihre erste Zeit bei OnlineReports.
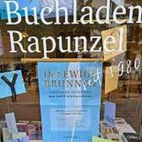
Nach 43 Jahren ist
Schluss für Rapunzel
Schluss für Rapunzel
Die Buchhandlung im Liestaler Kulturhaus Palazzo schliesst Ende Januar.
 |
Reaktionen |
www.onlinereports.ch - Das unabhängige News-Portal der Nordwestschweiz
© Das Copyright sämtlicher auf dem Portal www.onlinereports.ch enthaltenen multimedialer Inhalte (Text, Bild, Audio, Video) liegt bei der OnlineReports GmbH sowie bei den Autorinnen und Autoren. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Veröffentlichungen jeder Art nur gegen Honorar und mit schriftlichem Einverständnis der Redaktion von OnlineReports.ch.
Die Redaktion bedingt hiermit jegliche Verantwortung und Haftung für Werbe-Banner oder andere Beiträge von Dritten oder einzelnen Autoren ab, die eigene Beiträge, wenn auch mit Zustimmung der Redaktion, auf der Plattform von OnlineReports publizieren. OnlineReports bemüht sich nach bestem Wissen und Gewissen darum, Urheber- und andere Rechte von Dritten durch ihre Publikationen nicht zu verletzen. Wer dennoch eine Verletzung derartiger Rechte auf OnlineReports feststellt, wird gebeten, die Redaktion umgehend zu informieren, damit die beanstandeten Inhalte unverzüglich entfernt werden können.
Auf dieser Website gibt es Links zu Websites Dritter. Sobald Sie diese anklicken, verlassen Sie unseren Einflussbereich. Für fremde Websites, zu welchen von dieser Website aus ein Link besteht, übernimmt OnlineReports keine inhaltliche oder rechtliche Verantwortung. Dasselbe gilt für Websites Dritter, die auf OnlineReports verlinken.